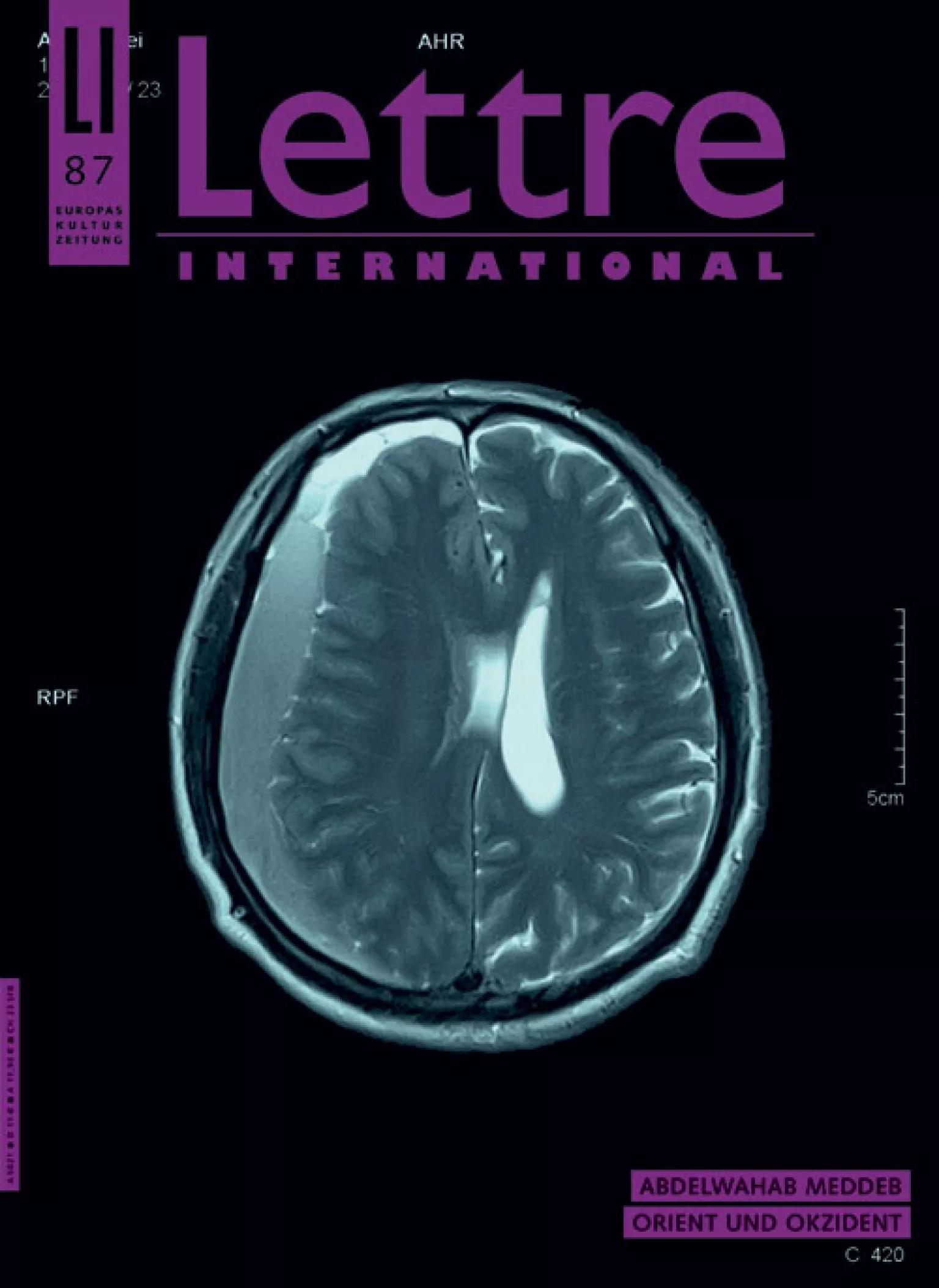LI 87, Winter 2009
Urheber ohne Recht
Wie Staat und Bürokratie mittels Open Access Wissenschaftler enteignenElementardaten
Textauszug
Der neben Google wichtigste Akteur auf dem Feld der Digitalisierung ist der Staat, der sich seit einiger Zeit dem Ziel der Digitalisierung von Wissenschaft verschrieben hat. Damit hat er sich freilich von vorneherein in ein doppeltes Konkurrenzverhältnis zu Google gesetzt: Er muß, will er mit Google mithalten, derselben Logik des raschen Digitalisierens großer Textmengen folgen, und er muß, anders als Google, diese Digitalisierung auf rechtskonforme Weise betreiben. Denn als Staat ist er auf das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit verpflichtet und muß es folglich dem Wissenschaftler überlassen, ob und wann und wie und wo dieser einen Artikel oder ein Buch veröffentlichen will. Nun braucht man nicht lange nachzudenken, um zu sehen, daß das Ziel der raschen und das Ziel der rechtskonformen Digitalisierung in einem Spannungsverhältnis stehen: Wer sich an das Recht hält und die Wissenschaftler fragt, ob sie digital publizieren wollen, muß ihr mögliches Nein akzeptieren und wird daher aufgrund dieses rechtskonformen Verfahrens niemals jenes Digitalisierungstempo vorlegen können, mit dem Google die Öffentlichkeit so sehr zu beeindrucken sucht. Für den Staat heißt das, daß er entweder die Rolle des großen Innovators und Konkurrenten von Google ablegen – oder einen Weg finden muß, um sein eigenes Recht umgehen und das Digitalisierungstempo anziehen zu können.
Das Spannungsverhältnis löst sich auf, wenn man als Staat die Notwendigkeit des Fragens und damit das mögliche Nein der Autoren erst gar nicht zum Thema macht, sondern die Digitalisierung von Wissenschaft über den Aufbau einer staatlich geförderten Publikationsinfrastruktur betreibt, die dem Wissenschaftler faktisch keine Wahl mehr läßt. Dann kann man als Staat den Google-Trick des Nichtfragens, aber Machens kopieren, ohne sich dem Vorwurf des direkten Rechtsbruchs aussetzen zu müssen. Man kann dann sonntags die Wissenschaftsfreiheit predigen, um sie den Rest der Woche bequem zu ignorieren. Die Kopie dieses Google-Tricks ist das, was als Open Access zu beobachten ist: die großangelegte Digitalisierung wissenschaftlicher Veröffentlichungen unter Umgehung des Urheberrechts und der Wissenschaftsfreiheit, zum angeblichen Besten der Menschheit. Das müssen wir uns näher anschauen.
Öffentlich sichtbar wurde Open Access mit der im Jahre 2002 publizierten Budapester Erklärung. Darin heißt es: „Open Access meint, daß diese Literatur [die wissenschaftliche Zeitschriftenliteratur, U. J.] kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, so daß Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem Internetzugang selbst verbunden sind. In allen Fragen des Wiederabdrucks und der Verteilung und in allen Fragen des Copyrights überhaupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den jeweiligen Autorinnen und Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu belassen und deren Recht zu sichern, daß ihre Arbeit angemessen anerkannt und zitiert wird.“
Nun mag es für einen Wissenschaftler in der Tat die größte Befriedigung darstellen, recht häufig zitiert zu werden. Aber in der Freude über häufige Zitationen darf man nicht übersehen, daß es essentiell zum wissenschaftlichen Geschäft gehört, daß der Wissenschaftler Herr über seine Publikationen bleibt, sei es, um dieses oder jenes Versehen korrigieren, sei es, um einen Text gegebenenfalls vollständig zurückziehen zu können. Ebendiese Kontrolle gesteht Open Access den Wissenschaftlern aber gerade nicht zu, denn Open Access hat sich zum Ziel gesetzt, auch die juristischen Barrieren beim Umgang mit Texten zu beseitigen, indem man den Autoren Lizenzen andient, die, wie die Creative-Commons-Lizenzen, nicht widerrufbar sind oder die, wie die GNU General Public Licence, es dem Leser eines Textes ermöglichen, diesen Text zu verändern und den veränderten Text (unter Kenntlichmachung der veränderten Passagen) weiterzugeben. Das mag nun zwar der juristische Triumph der Rezeptionsästhetik sein, aber es hat mit dem wissenschaftlichen Publizieren, wie es seit der Antike praktiziert wurde, nicht mehr das geringste zu tun. Denn an die Stelle des von seinem Autor verantworteten letztgültigen Textes tritt ein undurchschaubares Sammelsurium von nicht mehr oder nur noch teilweise gültigen Vorab- und preprint-Versionen, hinter denen die letztgültige Textversion verschwindet; das Ganze dann potenziert durch Textversionen, in denen bastelwütige Leser in den ursprünglichen Text hineinmontiert haben, was sie für richtig halten, der originale Autor aber ausgestrichen hätte.
Das alles ist kein Spaß, den sich einige wissenschaftsfremde Weltverbesserer mit der Wissenschaft erlauben, vielmehr ist hier bitterer wissenschaftlicher und politischer Ernst am Werk. Denn spätestens als im Herbst 2003 namhafte internationale und deutsche Forschungsorganisationen die Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen unterzeichneten, wurde Open Access auf die Agenda der deutschen Forschungspolitik gesetzt. Dabei nahm man keineswegs Anstoß an den urheberrechtsfeindlichen und die Wissenschaftsfreiheit aufkündigenden Formulierungen der Budapester Erklärung, sondern erklärte öffentlich, ein wissenschaftliches Publikationswesen aufbauen zu wollen, in dem unwiderrufliche Lizenzen und die Freiheit zum wissenschaftlichen Text-Patchwork der Normalfall sein sollten. Um es in den Worten der Berliner Erklärung zu sagen: „Die Urheber und die Rechteinhaber solcher [wissenschaftlichen] Veröffentlichungen gewähren allen Nutzern unwiderruflich das freie, weltweite Zugangsrecht zu diesen Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese Veröffentlichungen – in jedem beliebigen digitalen Medium und für jeden verantwortbaren Zweck – zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird. (Die Wissenschaftsgemeinschaft wird, wie schon bisher, auch in Zukunft Regeln hinsichtlich korrekter Urheberangaben und einer verantwortbaren Nutzung von Veröffentlichungen definieren.) Weiterhin kann von diesen Beiträgen eine geringe Anzahl von Ausdrucken zum privaten Gebrauch angefertigt werden.“
Die Umsetzung dieser Ziele stellt sich die Berliner Erklärung so vor, daß man die mit Forschungsmitteln unterstützten Forscher „darin bestärk[t], ihre Arbeiten gemäß den Grundsätzen des Open Access-Paradigmas [sic] zu veröffentlichen“. Und weil man dann doch nicht ignorieren konnte, daß man mit der ganzen Sache quer zum geltenden Urheberrecht und der Wissenschaftsfreiheit steht, versichert man den Lesern ganz zum Schluß, daß man „die Weiterentwicklung der bestehenden rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen“ unterstütze, „um die Voraussetzungen für eine optimale Nutzung eines offenen Zugangs [zu wissenschaftlichen Publikationen] zu ermöglichen“. Was hier als „Bestärkung“ und „Weiterentwicklung“ ganz zwanglos daherkommt, stellte sich freilich schon auf halbem Wege vom Jahr 2003 ins aktuelle Jahr 2009 als durchaus zwanghaft heraus. Denn als es um die konkrete Umsetzung dieser Ziele ging, las man im Jahre 2006 in einem Papier der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem wichtigsten und finanziell potentesten Akteur der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, plötzlich nicht nur davon, daß die Bereitschaft zum elektronischen Publizieren gemäß Open Access durch „externe Anreize“ gestärkt werden sollte, man las im selben Papier nur einen Satz später das kaum kaschierte Bedauern darüber, daß die „Hochschulleitungen, die am ehesten einen gewissen (institutionellen) Druck ausüben könnten, … bislang allerdings eher zurückhaltend [sind] bei der aktiven Propagierung elektronischer Publikationen“.
Um der Sache folglich auf die Sprünge zu helfen und die nötigen „externen Anreize“ in Form „eines gewissen (institutionellen) Drucks“ zu setzen, stellten die Allianzorganisationen kurzerhand ihre Förderpolitik auf Open Access um. Das bedeutet konkret, daß diejenigen Forscher, die seither etwa bei der DFG einen Antrag auf Forschungsförderung stellen, mit der Erwartungshaltung der DFG konfrontiert werden, ihre geförderten Forschungsergebnisse per Open Access zu veröffentlichen. So heißt es in den DFG-Verwendungsrichtlinien für die Exzellenzeinrichtungen, mit deren Hilfe man bundesweit die berühmten wissenschaftlichen „Leuchttürme“ in die graue Nacht des wissenschaftlichen Durchschnitts stellt: „Die DFG erwartet [sic], daß die mit Mitteln der Exzellenzinitiative finanzierten Forschungsergebnisse zeitnah publiziert und dabei möglichst auch digital veröffentlicht und für den entgeltfreien Zugriff im Internet (Open Access) verfügbar gemacht werden. Die entsprechenden Beiträge sollten dazu entweder zusätzlich zur Verlagspublikation in disziplinspezifische oder institutionelle elektronische Archive (Repositorien) eingestellt oder direkt in referierten bzw. renommierten Open Access Zeitschriften [sic] publiziert werden.“ Was diese Formulierung für einen antragswilligen Forscher bedeutet, liegt auf der Hand: Er formuliert den Antrag so, daß die „Erwartung“ der DFG bedient wird, ohne lange darüber nachzudenken, ob die DFG eine solche Erwartung, die der Wissenschaftsfreiheit hohnspricht, überhaupt haben darf. Wobei die DFG, die ja als Selbstverwaltungsverein von Wissenschaft auftritt, sich jederzeit darauf berufen kann, daß das, was sie „erwartet“, der selbstverwaltete Gemeinschaftswille der deutschen Forscher ist. Damit sind dann der Wille zu Open Access und der damit verbundene Abbauwille in Sachen Wissenschaftsfreiheit aufs schönste dadurch legitimiert, daß die Wissenschaftler in ihrer Gesamtheit es offenbar genau so haben wollen. Wer als Wissenschaftler dagegen Einwände erhebt und etwas anderes will, der kann diese seine Einwände und seinen eigenen Willen nur noch als ohnmächtigen Eigenwillen gegen einen übermächtigen Kollektivwillen stellen, um hinfort die undankbare Rolle eines wissenschaftlichen Michael Kohlhaas zu spielen. Kurz und gut: Die Wissenschaftler werden von den Allianzorganisationen mit einer Förderpolitik konfrontiert, die ihnen die freie Wahl des Publikationsweges nimmt.
(...)