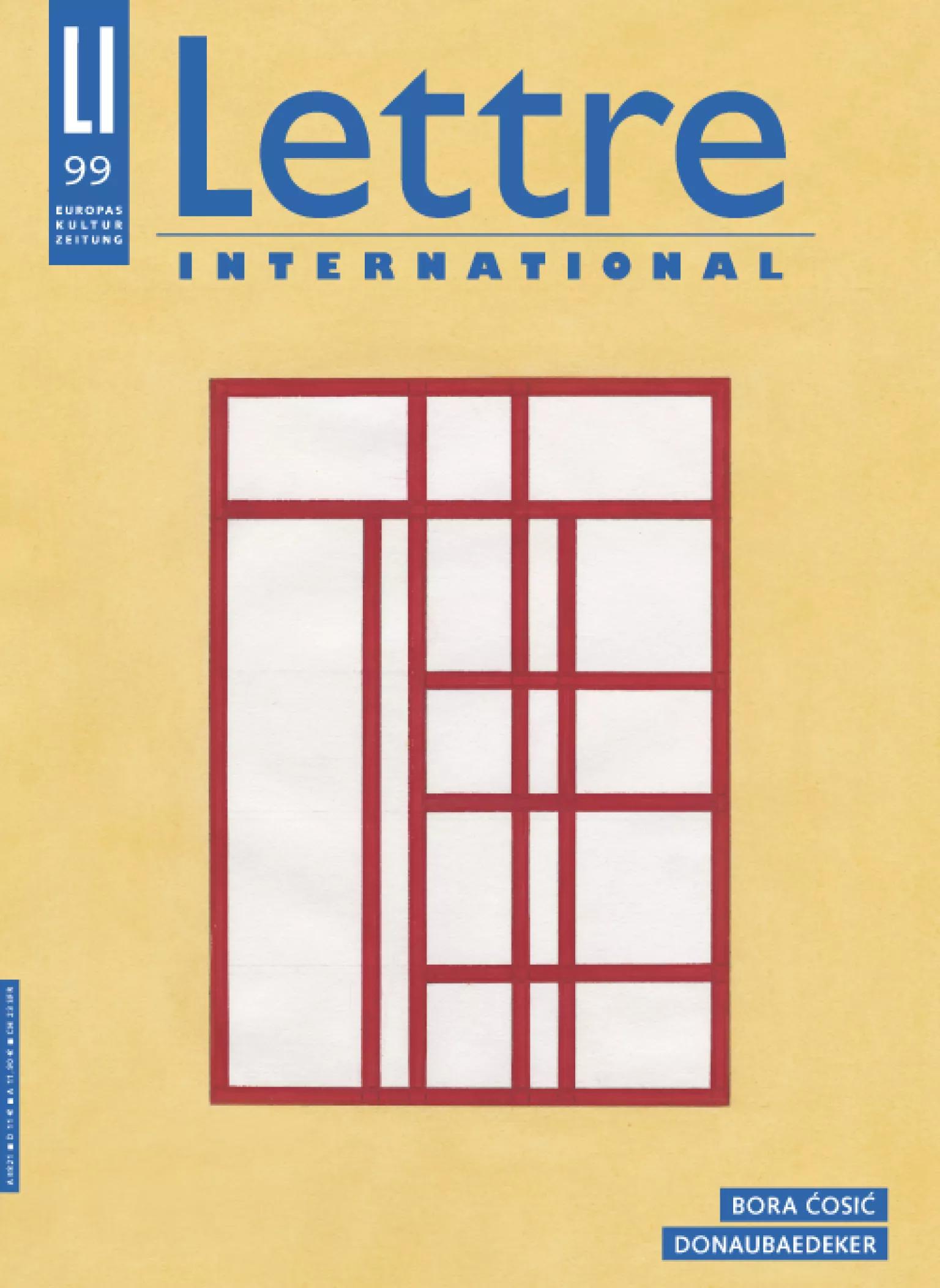LI 99, Winter 2012
Donaubaedeker
Eine trunkene Reise in einem herrlichen Herbst von Linz bis nach WienElementardaten
Genre: Reisebericht
Übersetzung: Aus dem Serbischen von Katharina Wolf-Grießhaber
Textauszug: 11.958 von 81.404 Zeichen
Textauszug
Die Donau beginnt ihre Geschichte nicht hier in Linz, sie hat da schon ein ganzes Stück ihres Schicksals hinter sich, trotzdem habe ich diese Tour irgendwie in der Mitte angefangen, wie wenn ich ein Buch wer weiß wo aufschlage und dann von dort aus weiterlese. Hier hat Bruckner komponiert und Adalbert Stifter seine dichte Prosa geschrieben, ich habe gleich schon alles, es reicht, daß ich mich kurz auf dem Hauptplatz niederlasse, wie in einer Muschel, die weiterhin rauscht. Dort gibt es ein Hotel von ungewöhnlichem Aufbau, eher kommt mir diese Niederlassung für Reisende wie eine Mietskaserne aus meiner fernen Vergangenheit vor, Veranden, die den engen Hof umrahmen, altmodische Vorhänge an den kleinen Fenstern, wer weiß, in welche Zeit ich mich da verirrt habe, voller Anachronismen. Weil dies jetzt nicht nur das ist, was man in diesem Augenblick sieht, unsere grammatische Jetztzeit ist eine große Falle für die Volksschüler des Lebens, jener Lauf, ähnlich dem der Donau, lehrt uns nicht nur, daß wir in diesem Augenblick überall sind, sondern man könnte sagen, auch immer. So leben wir ein paar Tage, ich und meine Gefährtin, in dieser Vergangenheit mitteleuropäischen Wohnens, und ich denke, ich bin noch immer in jenem Gebäude in der Knez-Mihailova-Straße in Belgrad, im Jahre 1938 oder 1939. In diese ferne Stadt wird dieser mächtige Fluß ohnehin in ein paar Tagen einlaufen, mit seinem sicheren, durch nichts aus der Ruhe zu bringenden Lauf.
(…)
Neuer Wein, guter Kuchen
Und dann, während ich in einem der gastfreundlichen Heurigen überall in diesem Tal sitze, speziellen Kneipen nur für eine gewisse Zeit und gerade diese aktuelle Saison, Weinsaison, begreife ich, daß das Getränk der Menschen auch hier auf die alte, so bezaubernde, großväterliche Art konsumiert wird. Es war stürmisch in diesem slawonischen Teil meiner Kindheit und im gleichen Teil des Jahres, nach der Lese, bis zu den Weihnachtsfeiern. Wenn mein Großvater, mein Vater und meine Onkel in den tiefen Keller wie in die Arche Noah hinabstiegen, um den neuen Wein zu probieren, aber von dort nicht mehr ohne weiteres zurückkommen konnten, sondern die Bediensteten sie auf dem Rücken in die übrige Welt hinaufbrachten, damit sie, sofern sie es konnten, aufs neue die Sterne sähen.
Danach kommen die Düfte, die besonderen, die den Süßigkeiten entströmen. Jetzt sind wir bereits ganz auf der Reise in die Kindheit, besonders in meine, die slawonische und großmütterliche. Weil meine Oma (geboren in Graz) von hier, aus Österreich, kam und sich erst danach in eine alte serbische Familie mit einer jahrhundertelangen Tradition, einer Popentradition, einfügte. Mit dem Familienbrauch, den orthodoxen Geistlichen zu stellen, brach die Generation meines Großvaters, er selbst war Besitzer, Weinbauer und passionierter Gärtner. Und meine Großmutter, sie buk Kuchen, deren Duft nun auch nach sieben Jahrzehnten in meine Nase steigt, da, in dem niederösterreichischen Tal, als wir den Weg in ein interessantes Städtchen mit einem etwas französischen Namen, Langenlois, einschlagen. Und damit diese mehrere Sinne betörende Atmosphäre erhalten bleibt: Unser dortiger Feinbäcker ist offensichtlich Tscheche, Svoboda. Werden in diesem Land überall Kuchen gebacken – wir erinnern uns an den mythischen Namen Oscar Pischinger –, war nicht einer der Neffen aus der Familie des Schriftstellers Musil ein berühmter Kuchenbäcker, dessen Kochbuch man noch immer in einem erlesenen Antiquariat finden kann? Aber Svoboda, er zeichnet sich aus durch den eigenen Geschmack, den er in seine Cremeschnitten bringt, über diese wacht er offensichtlich sehr, solange er sie nicht ganz fertig hat, und wenn er sie aus der, scheint mir, geheimen Backstube in das Geschäft am Platz trägt, ist es, als trüge er ein Kind in den Armen oder wenigstens einen tierischen Liebling. Ich weiß nicht, was alles notwendig ist, um ein Produkt dieser Art zu etwas Besonderem und außergewöhnlich Verführerischem zu machen, aber ich bin sicher, daß es bei dieser Arbeit unerhörte Geheimnisse geben muß, dann Geduld und dazu menschliche Fröhlichkeit. Die ganze besondere Atmosphäre, und nicht nur die gut gebackenen und gefüllten Teigblätter, nehmen wir dann, zweimal in der Woche, mit nach Hause, nach Krems. Was alles in einem Würfel dieser Erfindung steckt, bleibt unklar, auch nachdem wir ihn mit großem Genuß verspeist und so unsere Kinderzeit ins Unendliche verlängert haben. Man müßte doch schon einmal wissen, wieviel von etwas im Kuchen ist, das sich gegen jede Bosheit richtet, in ihm ist, scheint mir, alles dem Häßlichen, der Wut, dem Haß entgegengesetzt. Kann ein Mensch mit schlechtem Charakter eine Süßigkeit essen, ohne zu verstehen, daß diese seinem ganzen Wesen völlig zuwiderläuft? Ist es möglich, im Kuchen nur Trost zu suchen, eine puerile Belohnung für das eingeengte Leben des Kindes, das durch die Macht der Umstände gewissermaßen immer von den Erwachsenen unterdrückt wird? Dann kommen die Serien von Kompensationen bei vielen neurotischen Personen, die oft zu einem tragischen Vollstopfen des Körpers bis zu den Dimensionen auf den Bildern von Botero führen. Daher möchte ich die Struktur eines Kuchens schützen, der nicht nur seine Vorzüge beim Verkosten hat, der Kuchen ist eine künstlerische Schöpfung, ein fast architektonisches Objekt, nur verkleinert. Ein Kuchen ist außerdem nichts Einfaches, wie es einem Bengel scheint, wenn er ihn mit zwei Bissen verputzt. Weil sein junges Bewußtsein noch nicht versteht, daß er in diesem Augenblick ein vielschichtiges Ganzes verschlungen hat, es gibt, da bin ich sicher, in dieser Zuckerbäckerschöpfung etwas, das so verhüllt und eingewickelt ist, nicht nur in ihre Oblaten. Ich möchte das essayistische Wesen dieses profanen, verrufenen, leckeren Stückchens Kuchen oder Torte feststellen, das jedes gefüllte Eßbare hat, wie schon die mittelalterlichen Mönche sehr gut wußten. Der Kitsch (die unvermeidliche Maske des Kuchens) verkündet außerdem ein weiteres Mal seine Ästhetik und sein keineswegs einfaches Wesen. Und wo sonst könnte man so viele Charakteristika einer, sagen wir, Ischler Torte finden, wenn nicht in dieser Gegend, der Wiener und eigentlich der gesamtösterreichischen? Man sollte das unterhaltsame Büchlein von Lojze Wieser über Speisen, gesalzene und süße, aus seiner Kärntner Kindheit lesen. Dies könnte ein besseres Handbuch gegen den Rechtsradikalismus seiner Gegend sein als vieles andere. Weil in diesen einfachen kulinarischen Unterweisungen eine Geschichte erzählt wird, die genügt, um diese ganze ansonsten sanfte Kärntner Region zu erkennen, jeden Berg und jeden Wald.
(…)
Wiener Drehungen
Hat nicht gerade ein eminent wienerischer Philosoph, Wittgenstein, gemeint, die Welt zerfalle in Tatsachen? Ich meine, das bezog sich sowohl auf Begriffsinhalte als auch auf die in den Dingen verkörperten Stückchen. Ein anderer Philosoph, Sloterdijk, sieht darin Wittgensteins Unvermögen, kohärente Formen zu bilden, und enthüllt das Schicksal des zum Minimalismus des Satzes verurteilten Denkers. Deshalb füge ich diesem Magazin der Gegenstände jenes andere hinzu, jenes aus dem Bereich der Sprache. Tatsächlich ist Wittgenstein ein Denker, der ein Werk aus einzelnen Sätzen hinterlassen hat.
Geblieben ist, daß in der blitzenden Rumpelkammer der Wesen dieses Standes ein Durcheinander von städtischen und bürgerlichen Spielen aufgeführt wird, ihr ununterbrochener Walzer. Diesen können wir daher nicht als Tanz betrachten, sondern als Weltanschauung. Der Tango ist, sagen wir, die südliche, kreolische und südamerikanische Antwort auf das, was in Wien komponiert wurde; mit seinen Stakkati, seiner Melancholie und dichten Erotik stellt er ebenfalls ein Denkmodell her; der Walzer wurde indes geschaffen, um den Kreisel des Wiener und mitteleuropäischen Lebens von unlängst zu bestimmen. Und seines Todes vielleicht. Dieses makabre Motiv entdeckt Schorske in der Komposition von Ravels La valse. „Ich empfinde dieses Werk“, schreibt der Komponist, „als eine Art Verherrlichung des Wiener Walzers, die in meiner Vorstellung verbunden ist mit dem Eindruck von einem phantastischen Wirbel des Schicksals.“ Auf jede Art ist irgendein Kreisel eingebaut in die ersten Rührgeräte und Mixer der Wiener Küchen, in die riesigen Ausmaße des Rads im Prater, vor allem in den Dreivierteltakt der Strauss-Melodien. Dies wird im übrigen sehr schnell an der Grammophonplatte und ihren schwindelerregenden Drehungen deutlich. Auch die Architektur, die urbanistische Absicht dieser Stadt, scheint von diesen wirbelartigen Kreisbewegungen bestimmt zu sein, die Wiener Prachtbauten haben ebenfalls in einem Walzer ihre Ringe beschrieben. Denn Wien hat sich bei einer Verlobung von Stein, Blumen und Musik selbst einen Ring angesteckt. Weil auch die Parks, ihre Pfade, Blumenbeete, die Schloß- oder Straßenparks, teilhaben an diesem Einkreisen, an diesem Ausschließen aus der ganzen übrigen Welt, wie es das frühere Wienertum getan hat. Diese Einkreisungen erstrecken sich auch in die Tiefe und in die Sphären von Gedanken, Wissenschaft und Poesie. Daher fallen mir die Kreise ein, die literarischen, journalistischen und standesmäßigen, die runden Tische des Wiener Geisteslebens, auch dann, wenn diese Tischchen mit Marmorplatte ganz viereckig waren. An denen Karl Kraus, Beer-Hofmann, Schnitzler, Theodor Herzl, Peter Altenberg saßen, das Mark jener Stadt und jenes Lebens.
Es gab in der modernen Kunst mehrere Momente, wo sich sehr europäische und städtische Künstler fernen Gegenden und fremden Menschen als Brüdern und Inspiratoren zuwandten. So entstand der Kubismus, diesen Weg war schon der unruhige Lautréamont gegangen, einmal Flaubert; André Gide wurde in seiner Jugend voll und ganz zum Afrikaner, und der Dichter Crnjanski entdeckte sein niemals erreichtes Sumatra. Aber das, diese Hana von Davičo, der Duft ihres Haares und ihrer Hände, diese Tochter eines Verkäufers von Waren aus den Tropen, das begleitet mich auch dann, wenn ich in einem Wiener Kaffeehaus ganz von einer kolonialen Atmosphäre umgeben bin; der europäische (vor allem der amerikanische) Eroberer hat aus den fernen Gegenden doch nicht nur in Ketten gelegte Sklaven herbeigeschafft, er hat den Glanz des blühenden Klimas und seiner irdischen Nahrung mitgebracht, mit sich und an sich. Wie die ersten Masken von Schwarzen an der Wand von Bretons Zimmer und im Atelier von Picasso die Brüderlichkeit mit einer anderen Rasse, wertvoll in ihrer Andersartigkeit, bestätigten.
(…)
Bleibt mir, der Donau, diesem mächtigen Fluß, einige Konnotationen, vielleicht philosophische, zuzuordnen. Bereits Heraklit hat den Fluß mit seiner Replik in die Sphäre der metaphysischen Erwägungen eingeführt, sein Wasser ist seither nicht nur profan durchsichtig, es verwandelt sich in den Ganglien der Weisen in ein dichtes Gewebe, in ein Material, welches das dialektische Bild jeglicher menschlicher Bewegung baut. Das unterstützen heutzutage so viele Geräte der aktuellen Zivilisation, deren Instrumente und deren Errungenschaften dem Flußlauf entspringen, wie dieser selbst aus jener Quelle im Schwarzwald hervorgeht. „Fernseher und Fernsauger“, sagt der Philosoph Sloterdijk, „schöpfen aus einer verflüssigten Welt“. Flüssig kann etwas Eßbares sein, flüssig kann man in einer Fremdsprache reden. Es fließt, in der Manier der Wiener Secession, auch der Fries, sogar die Streifen des Comics fließen, jene lustigen Bilder, die bewirken, daß auch das Auge des Betrachters diese Serie wahrnimmt, als wäre es in den Anblick eines Flußlaufs versunken.
Es ist nicht bedeutungslos, daß sich eine Gruppe von Künstlern in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, der amerikanische und europäische Fluxus, auf das Fließen gründet, eines Flusses, einer Zeit, eines Gedankens, eines Blutkreislaufs. Ich habe nicht die Absicht, diesen Lauf weiter aufzuhalten. Vor der Donau liegt noch ein gutes Stück Weges, jenes durch mein ehemaliges Land und weiter, hin zu ihrem dichterisch ganz und gar sezierten Delta.