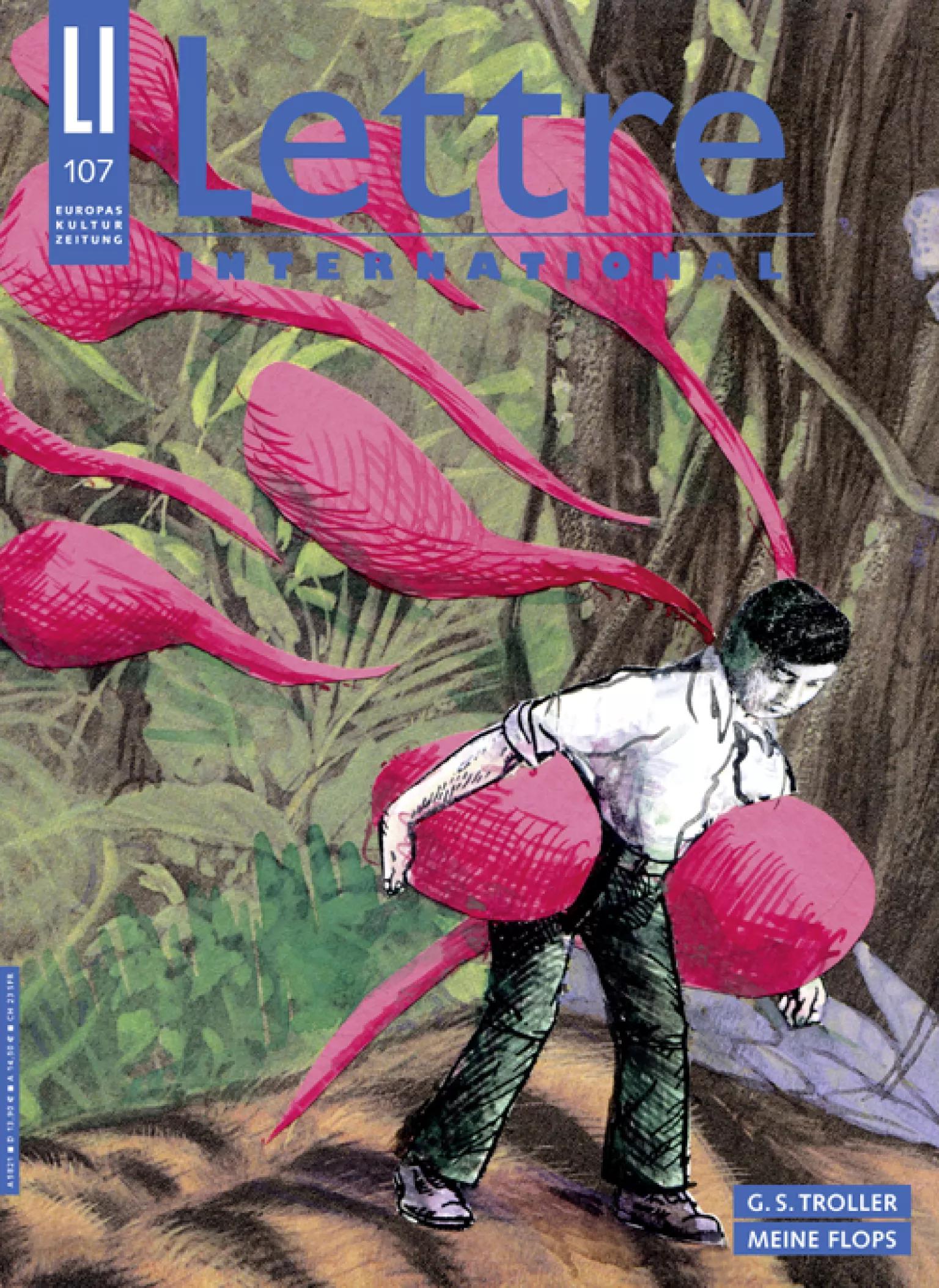LI 107, Winter 2014
Kölner Karneval
Elementardaten
Übersetzung: Aus dem Serbischen von Matthias Jacob
Textauszug: 17.967 von 78.039 Zeichen
Textauszug
Während Titos Konflikt mit Stalin schrieb der kroatische Dichter Miroslav Krleža seinen wütenden Text Sie schicken uns nach Asien!, wobei er dachte, dieses riesige Stück Festland, wo sich die unermeßliche Leere unbewohnten Landes ausbreitet, das Steppenleben, Nomadenstruktur, Hunnenmentalität, ein Sibirien des Menschenschicksals, sei für jegliche mongoloide Deformation menschlichen Lebens bestimmt. Und alles, was das Sein eines normalen Menschen ausmache, befinde sich anderswo. Dieses Anderswo wäre eigentlich hier, wo ich mich derzeit befinde, im Westen. Damit hat sich dieser Dichter, obwohl er durch und durch ein Linker war, für diesen Teil des kleinen europäischen Kontinents entschieden und unbewußt das bescheidene Aufflackern einer „Verwestlichung“ unterstützt, die sich bei uns, ehemaligen Jugoslawen, um 1950 ankündigte. In unserer gemäßigten Klimazone fällt es einem offenbar leichter zu atmen, deshalb verfiel man nicht der Verbannung, dieser Höhle jenseits der Karpaten, aus der einst vor langer Zeit unsere Vorfahren geflohen sind. Was für ein unvorsichtiger Sektierer war doch dieser Dichter, der sich über aktuelle Ereignisse empörte, die, wie er meinte, unseren bemitleidenswerten europäischen Kleinstaat in die falsche Richtung brachten! Und dabei übersah er die wertvolle Bedeutung des ganzen riesigen asiatischen Kontinents.
Außerdem beachtete der alte Barde nicht, daß Himmelsrichtungen nichts anderes markieren sollten als den eigenen geographischen Standpunkt in Bezug auf das Sonnenlicht. Dennoch haben die Menschen dieser eigentlich meteorologisch bedingten Tatsache räumlicher Unterschiede über die Jahrhunderte hindurch eine unerträgliche Last von Symbolen aufgebürdet, obwohl ein Lehmklumpen aus dem Fernen Osten in Wirklichkeit jenem ähnelt, an dem auch wir im Westen manchmal mit dem Fuß kleben bleiben.
Neulich stieß ein kroatischer Historiker in den Memoiren von jemandem aus jener Zeit, vor mehr als einem halben Jahrhundert, auf die Auffassung Churchills, der westliche Teil unseres untergegangenen Staates müsse zum Osten gehören, der östliche zum Westen. Weil sich unsere Partisanenverbände mehr in den westlichen Gebieten aufhielten, in Bosnien und Kroatien, während sich in Serbien, genau wie heute, die Tschetniks verlustierten. Also fehlte wenig und wir hätten unseren westlichen Osten, unseren östlichen Westen. Nur die hohe Kochkunst eines Josip Broz im Bereich der Politik verhinderte dieses Paradox und brachte es zu Wege, daß dieses, sei es auch noch so künstliche, jugoslawische Gebilde lange Zeit irgendwo dazwischen blieb.
So befinden sich auch die Himmelsrichtungen bei all ihrem ptolemäischen Scharfsinn in der Schwebe, beständig in ihrer Unbestimmtheit. Daher ist auch ihre Bezeichnung eine Sache menschlicher Vereinbarung. Mir scheint, daher stammt auch das Vorurteil, die politische Linke komme von der östlichen Richtung, das Konservative von der Westküste. Aber ist denn irgend etwas „Fortschrittliches“ und Progressives aus den Ansichten Lenins hervorgegangen, aus dieser progressiven Paralyse der Geschichte, die Millionen Menschen unter die Erde gebracht hat? Waren denn die Bolschewiken jeglicher Art nicht in vielerlei Hinsicht borniert, primitiv, also rückständig? Und was wiederum ist so „reaktionär“, „retrograd“ in dem Erdteil, der den Telegraphen erfunden hat, die Eisenbahn, die Dampfmaschine und wo Einsteins Formel aufgeschrieben wurde? Gerade seine Theorie hat bestätigt: es gibt weder rechts noch links, weder oben noch unten; was bedeuten würde, daß es auch keinen Osten und keinen Westen gibt. Das einzige, was existiert, ist ein gewisses inneres Raumgefühl, das im menschlichen Geist verankert ist und das ihm hilft, sich auch in einer unbekannten Stadt zurecht zu finden, auf Wiesen und im Wald. Das alles muß ich in meinem Kopf behalten, während ich mich derzeit im westlichsten Westen, den es gibt, aufhalte, hier an der belgischen Grenze und in der Nähe des Atlantiks.
(…)
Karneval ist etwas anderes, sagt Michail Bachtin, er war keine künstlerische theatralische Darstellungsform, sondern eine Art von wirklicher (wenn auch vorübergehender) Form des Lebens selbst, die nicht einfach inszeniert wurde, sondern in der man (in der Karnevalszeit) nahezu wirklich lebte. Das muß man hier im Sinn haben, wo im Kölner Umfeld der Karneval ein wesentlicher Punkt des gemeinschaftlichen Lebens ist. Es ist kein Zufall, daß der Name dieser Stadt seiner etymologischen Herkunft nach mit dem englischen Wort clown zusammentrifft, und dieses stammt zusammen mit dem Namen Kölns von colonus, Bauer, oder colon, Siedler. Dies bedeutet zugleich, daß die römischen Kolonisten, ursprünglich offenbar Bauern, an dieser Flußbiegung des Rheins ihre Kolonie gründeten, eine Festung, auf deren Fundament einmal die Kölner erzbischöfliche Hauptkirche erwachsen sollte; auf demselben Terrain sollte sich auch einmal die Tradition der Clowns einbürgern, die Clownerei, gewissermaßen die Chaplinade. Nichts anderes in dieser Stadt besitzt eine solche Kohäsionskraft, ein solches Ansehen, in der homogen gewordenen Einwohnerschaft als diese wenigen ganz verrückten, närrischen Tage im Februar. Ihr Nahen spürt man Monate zuvor, die Menschen bereiten sich tagelang auf diesen kurzen Ausflug in den fröhlich-kollektiven Wahnsinn vor, weil es nicht einfach ist, aus einem monotonen und oft bedrückenden Wohlstand in die Aura kollektiver Heiterkeit zu springen. Frei zu sein von den allzu gut bekannten Umständen, welche die geordnete, eigentlich angenehme, aber auch streßreiche Zivilisation des Westens hervorbringt, der anderen als das gelobte Land erscheint und als eine noch ferne Zukunft. Der Karneval ist dann nicht bloß dieser Einschnitt in die bedrückende Rigidität des Alltags und die allzu ernste Auffassung eines jeden Lebensabschnitts, der Karneval entzündet in Herzen und Seelen selbst der düstersten und verrücktesten Individuen plötzlich einen Funken, den auch der allerletzte ängstliche Neurotiker in sich birgt; es braucht nur die Unmenge an närrischen Veranstaltungen auszubrechen, auf dem Hauptplatz der Stadt, und vor allem in den Cafés, den Bierkneipen Nordrhein-Westfalens.
(…)
Die großen mittelalterlichen Städte, sagt Bachtin, lebten bis zu drei Monate im Jahr ein karnevaleskes Leben. Das kann sich die heutige Kölner, westdeutsche und allgemein die westeuropäische Zivilisation nicht erlauben. Man kann nicht alle Maschinen von Siemens und von Wolfsburg auf unbestimmte Zeit anhalten, das gestattet man sich heute allenfalls in Serbien und anderswo im Osten, eine mehrtägige Zeitvergeudung ohne Ziel und Ende, des Essens und des Trinkens wegen. Daher, in allem vorsichtig und zurückhaltend, komprimieren die Menschen in Westeuropa ihren karnevalesken Ausbruch in nur wenigen Tagen, weshalb er auch aussieht wie eine verdichtete Narrenzeit, kurz aber umfassend verbracht im karnevalesken Treiben, in karnevalesker Denkweise.
Ich konnte dies alles nicht vergessen, als ich die zauberhafte Anhöhe, den Zauberberg oberhalb Kölns bestieg, den Petersberg. Schon diese Serpentinenkurven durch goldene Wälder und winzige Auen, die wie aus Plüsch gemacht waren, der ganze Aufstieg, waren eine wahrhafte Anabasis meines Lebens der vergangenen Monate, all das sprach davon, daß es nicht nur diesen Aufenthalt im Tal gibt, im Alptraum einer planlos-städtischen Struktur und ihrer verwirrenden Geschichte, sondern daß man aus jenem Rauch und Nebel und aus der Neurasthenie einer ziemlich konfusen Großstadt zu einem Plateau der Annehmlichkeit gelangen kann, nicht bloß glänzender Hallen und gastfreier Tische, dort oben, wo oft Staatsmänner, Wissenschaftler, Praktiker und Menschen aus der Republik der Phantasie zusammenkommen. Dann kann man schließlich in die Tiefe schauen, auf das dort ausgebreitete Kölner Staatswesen, das von hier aus betrachtet auch kein Ende hat. Und wartet man bis zum Abend, wird im nächtlichen Licht dieses Lebensnetzwerks neben dem mächtigen Fluß auch diese Stadt alles in allem schön und freundlich wirken. Weil jemandes Blick sie dazu macht, aber nicht sie selbst und ihr kompliziertes Schicksal.
Hier, auf dieser Anhöhe, stelle ich mir vor, in den folgenden Tagen ein ungezwungenes Treffen freundlicher Leute zu veranstalten, wiewohl nicht nur Dichter dabei wären, Barockdichter oder nicht, sondern alle, die mich mit Deutschland verbinden, Menschen, denen ich in zwei Jahrzehnten begegnen durfte, die ich kennenlernte und mit denen ich befreundet bin. Hoffentlich wären auch solche dabei, die ich nur beiläufig kenne, die mir jedoch wichtig erscheinen, weil sie das geistige Umfeld meiner neuen Heimat markieren. Mit einigen von ihnen sind die freundschaftlichen Beziehungen einfach und problemlos, mit anderen schwieriger und komplizierter. Trotzdem verzichte ich nicht darauf, gerade auch solche Leute auf diesen Berg zu bringen, die allzu bescheiden sind, sogar solche, welche die Russen „zastenčivyj“ (schüchtern) nennen, die sich hinter den Mauern ihrer Häuser verkriechen und die man von dort schwer herausbekommt. Aber ich denke, gerade eine solche auf das Innenleben konzentrierte Gruppe der Deutschen sollte meine Karnevalsbühne betreten.
Jetzt sehe ich schon, wie entlang dieser schmalen, aber saftigen Wiesen und zwischen erlesenen Bäumen hindurch über weiches Gras und Sandwege die Menschen hinaufsteigen, die ich ausgewählt habe, die ich zu diesem Bankett einladen wollte. Und unter den ersten von meinen Nachbarn in der Poesie trippelt da wie mir scheint an der Spitze dieser Armee die kleine Poetessa Herta Müller daher, ganz in Schwarz, aber fröhlich, mit großen Augen, welche eine ganze Welt zu umfassen vermögen. Auch Buch müßte hier dabei sein, Delius und Peter Schneider und auch der grimmige, hagere, kluge Michael Lentz, dann wäre es lustig, Marica Bodrožić und Juli Zeh zu sehen – sie alle mit Packtaschen auf den Rücken, mit den Spuren ihrer poetischen Wanderungen; es war schwierig, sie aus so weitentlegenen Gegenden zusammenzubringen. Ich sehe, daß auch Genazino nicht taub war für die Einladung, ein kräftiger, lieber Mensch, der beim Aufstieg ganz außer Atem geriet. Etwas gönnerhaft gegenüber allen anderen, taumelt ein hochgewachsener Mann mit Wuschelhaar nach oben, der spöttische Hanno Strasser. Wie ist dieser alte Mann darauf gekommen, daß er den steilen Hügel auf einem Maulesel erklimmt, der ziemlich brav und ohne den ihm zukommenden Eigensinn war, hartnäckig blieb sein Reiter, der beim Reiten an seiner Pfeife zog und nach der Seite ins Gras ausspuckte? Neben ihm gingen einige Dichter, die eigentlich niemand eingeladen hatte, die uns aber sicher nützlich sein werden, oder auch andere, die ich unbedingt erwarte. Ganz für sich geht jetzt mit gazellengleichem Schritt eine Figurine unter den Dichterinnen hinauf, die alabasterartige Ilma Rakusa. Ganz besonders bemühte ich mich, meinen alten Freund Klaus Theweleit hierher einzuladen. Ich habe ihm nicht unbedingt versichert, daß wir auf dem ovalen Dach dieses Gebäudes oben auf dem Berg sofort die rote Fahne hissen würden, aber, daß er hier seine dreistündige Rede gegen die schwarzen Mächte der Geschichte halten dürfe, das habe ich ihm versprochen. Es war schwer, mit Unterstützung anderer Menschen und zuverlässiger Beziehungen, die Maler davon zu überzeugen, ihre Pinsel und kräftigen Malspachteln zu verlassen und ihre futuristisch-unverständlichen Kunstgewerke eine Zeitlang gegen ein freundschaftliches Gespräch hier oben einzutauschen. Das gilt auch für diese wortkarge Dame, obwohl ich weiß, daß sie eben jetzt versucht, ein altes Opel-Modell an die Kuppel des Berliner Doms zu hängen. Es wäre nicht leicht, den größten hiesigen lebenden Philosophen hierher zu bekommen, wer könnte ihn wegbewegen von seinem See, aber dafür scheint mir, geht dieser wahrlich korpulente Denker mit holländischem Namen leicht schwitzend den Berg hinauf. Die eine oder andere kluge Journalistin würde den Ruhm dieser Zusammenkunft mehren, eine kritische Feder, und ich sehe, daß zumindest mein Freund da ist, der scharfzüngige, unersetzliche Erich Rathfelder. Es kommt mir vor, als sähe ich, daß flinke Photographen prompt der Einladung gefolgt sind, unter ihnen eine großartige Mitarbeiterin Keystones, Ayse Yavas, und mit ihrer Hilfe, hoffe ich, werden wir auch die erreichen, die ich noch immer nicht kenne, Barbara Klemm und Arno Fischer. Und diese würden mit ihrer ungeheuren Arbeit dem hier möglicherweise noch das eine oder andere Mosaiksteinchen hinzufügen, wenn sie diese immer größere, immer buntere Gruppe knipsen würden. Es gibt Menschen, ohne die unsere Schriftstellerei, unsere Malerei und all unser photographisches oder kompositorisches Arbeiten nicht viel taugen würden; was wären wir ohne diese Manager, Moderatoren, Intendanten und Direktoren, was wären wir ohne Oliver Zille, Uli Schreiber, ohne Joachim Sartorius und Herbert Wiesner?! Ihr jahrzehntelanges Wachen über eine lebendige Lesekultur, in den kleinen und großen Sälen deutscher Dichtkunst, ihre fein formulierten Einführungen zu jedem dieser Anlässe sind fast genauso viel wert wie die literarische Lesung, die man dann hört. So verbreitert sich mein Freundeskreis und die unbekannten und unerwarteten Helden des Alltags bereichern die Gruppe.
(…)
Dort, auf der anderen Seite, kümmerte sich Harry Rowohlt darum, diese Friedhofsatmosphäre zu erschüttern. Wieviel Petersberger Nektar schaffte er bloß in sich hineinzuschütten und damit eine kleine Gruppe um Manfred Krug zu erheitern (unglaublich, daß es gerade er war!?), die sich darauf vorbereitete, ein mittägliches Dixieland-Konzert aufzuführen. So hatte er es während der ganzen DDR-Herrschaft getan, warum also nicht auch jetzt, in der Freiheit dieser Anhöhe, im Westen! Trotzdem schaute der mißtrauische Michael Lentz vorsichtig durch die breiten Fenster in die endlose deutsche Landschaft, als wollte er sagen: Wo ist hier der Westen? Als ob das eine einfache Frage wäre. Weil wir alle zusammen nicht einmal wissen, was links oder rechts ist, geschweige denn etwas anderes. Und selbst in ein und demselben Land ist es schwierig, zu unterscheiden, was etwas ist. Lange hatte er geschwiegen, ein häufiger Gast dieser Gruppe, mein lieber Péter Esterházy irgendwo am Tischende, aber jetzt sagte er, man könne einen Staat nicht einteilen in solche, die Unrecht begehen und die Armen, die daran leiden. Daher war es gut, die Erklärung aufzuschnappen, die der Barde auf dem Maulesel einigen jüngeren Dichtern gab, ich sah dort auch die zierliche Poetessa Eva Diamantstein und den nachdenklichen Grünbein. Wie man ihn kennt, sprach er schon lange, wahrscheinlich auch vorher, aber es gelang mir, dies zu hören: … auch so etwas kam vor. Als die lutherischen Schweden über die lutherischen Dänen hergefallen waren. Wieso sagte er das? Nicht nur aus „politischen“ Gründen, deren er immer öfter überdrüssig wurde. Und dann antwortete er selbst: Wegen der Sprache, die man gründlich untersuchen muß. Weil der schwedische Freund mich sonst dazu provozieren würde, daß ich der Gruppe erkläre, in welcher Sprache ich schreibe, auf Kroatisch oder auf Serbisch, als ob man mich fragen würde: in westlicher oder östlicher Sprache. Mich rettete, daß man Fische aus dem Rhein zog. Ich erinnerte mich an lustige Ereignisse aus meiner Kindheit: meine Mutter hatte fürchterliche Angst, sie könne an einer Fischgräte ersticken, weshalb Fisch bei uns überhaupt nicht gegessen wurde. Ich dachte mir, unser Treffen könne eher an einer Unzahl von Themen ersticken, die nicht an einem Tag zu bewältigen sind. Trotzdem war es lustig. Eine Stimme protestierte alsbald: Es gibt keinen Butt! Das war immerhin ein zu bewältigendes Hindernis für den stämmigen Philosophen, der sich an die vorgegebenen Themen hielt, Links oder Rechts, der Westen oder der Osten, und schon damit an mein Ziel, wiewohl er auf eines nicht eingehen konnte: auf die Streitigkeiten zwischen dem Kroatischen und Serbischen. Für ihn war es wichtig, zwei bürgerliche Ich-Stile hervorzuheben (als existiere das Bürgertum noch immer!), einen älteren und einen neueren Typus, die aufeinander stark allergisch reagieren. In der gegenseitigen Abneigung etwa Thomas Manns und Bertolt Brechts wird diese Front konkret sichtbar. Ich sah, daß es Theweleit auf der Zunge lag zu fragen: Und auf welcher Seite stehen Sie? Aber er gab sich damit zufrieden, seinem Stör so beflissen den Kopf abzuschneiden, daß der Teller schepperte. Michael Lentz lächelte ein wenig. Als hätte er nichts bemerkt, fuhr der Philosoph fort, nicht eben geradlinig: Das Böse wird zum sogenannten Bösen, das Gute zum sogenannten Guten. Wir waren hart daran, alles um uns herum sorgsam zu relativieren. Die eine wie die andere Seite, jene wie diese Vorgehensweise. Ich glaube, er sagte nur noch dies: Was früher Hochstapelei hieß, nennt sich heute Expertentum. Und das war ein Zeichen dafür, daß wir uns sehr gut verstanden, daß wir im wesentlichen übereinstimmten, und man fürchtete nicht mehr, jemandem könne eine Fischgräte in der Luftröhre stecken bleiben. Da konnte auch ich aufatmen: Wir haben das alles nicht aus einem anderen Grund erdacht, sondern damit wir auf diesen Berg steigen und in der Niederung vieles zurücklassen, was uns nicht zusagt, jedem aus je eigenen Gründen. Der Alte erwähnte nochmals seinen Lieblingsdichter Stoffel, eine Person aus dem 16. Jahrhundert, die er aber gleichwohl in Telgte getroffen habe. Er wollte nur anmerken, daß nach seinem kreuzqueren Wissen, oft die Alten kindisch und die Kinder verständig, die Frauenpersonen grob, die Bauern züchtig und die ihm bekannten dapferen Helden, selbst wenn’s an Sterben ginge, lästerlich redeten. Dazu flüsterte ich Predrag zu, es gebe seltsame Antinomien, die nicht immer moralischer Natur seien, sondern völlig unklarer, eigener Art. So fand ich heraus, das in der Zeit der unbesonnenen Spaltung Deutschlands in zwei ungleichmäßige Teile im Westen die Prosa gedieh, im Osten die Lyrik. So denke ich, daß auch die Form etwas ist, was man aufteilen kann, diese hierhin, jene dorthin.
(…)