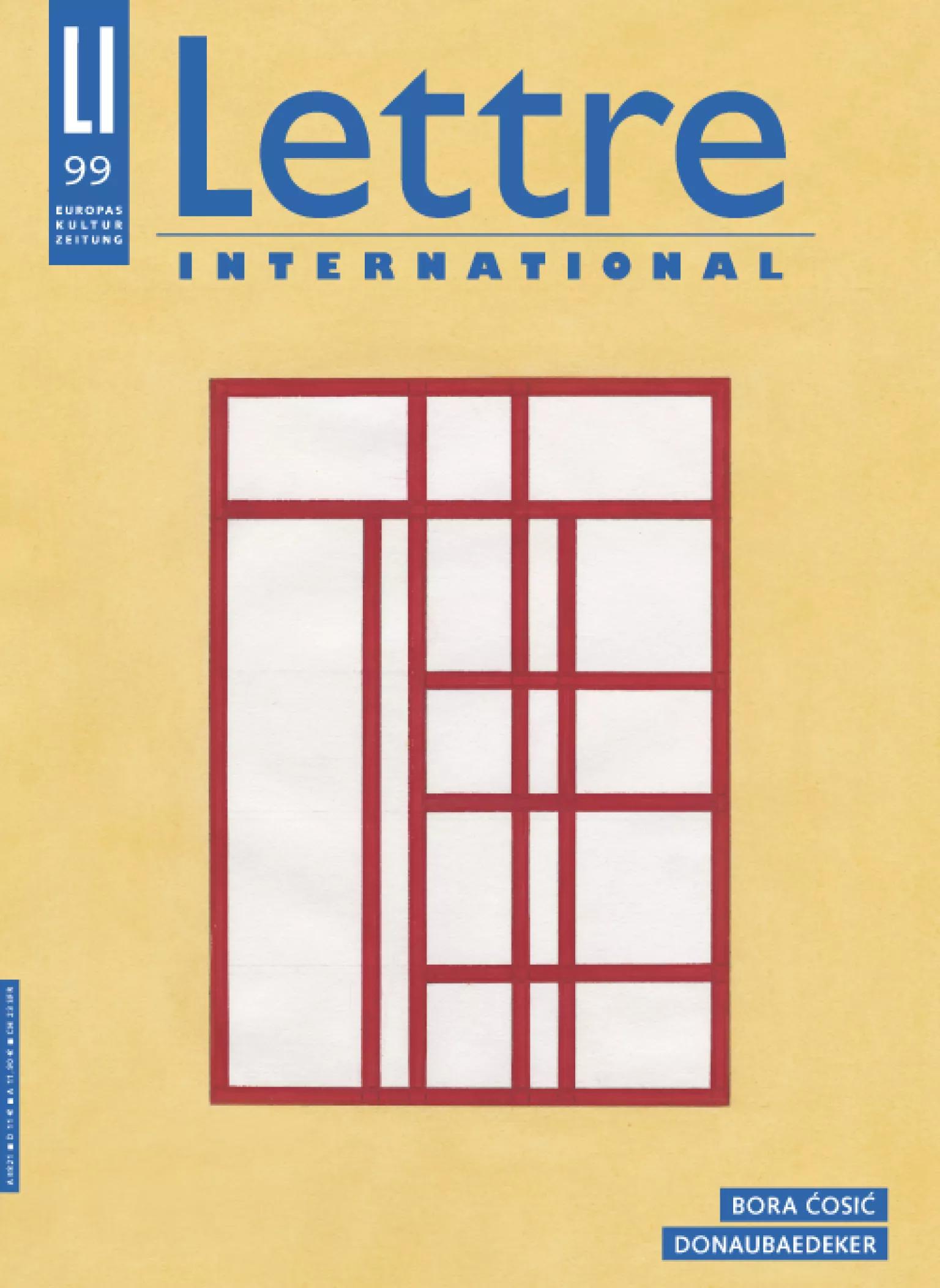LI 99, Winter 2012
Idee und Realität Indiens
Demokratie, Säkularismus, Einheit - Ideale und Schattenseiten der NationElementardaten
Genre: Essay, Historische Betrachtung
Übersetzung: Aus dem Englischen von Joachim Kalka
Textauszug: 18.890 von 154.891 Zeichen
Textauszug
Stabilität der Demokratie
Es besteht immer ein Widerspruch zwischen den Idealen einer Nation und der Praxis, in der sich diese Ideale zu verkörpern suchen oder zu verkörpern behaupten. Das Ausmaß der Widersprüchlichkeit kann natürlich verschieden sein. Im Falle Indiens ist der grundsätzliche Anspruch solide: Seit der Unabhängigkeit war das Land immer eine Demokratie; dafür ist es berühmt. Die Regierungen werden in regelmäßigen Abständen ohne Wahlbetrug frei von den Bürgern gewählt. Dies ist – obwohl man es oft annimmt – in sich selbst noch nicht einzigartig, was die Gruppe der Staaten betrifft, die man einmal die „Dritte Welt“ nannte. Sri Lanka, Malaysia, Jamaika und Mauritius haben ebenfalls seit ihrer Unabhängigkeit stets regelmäßige Wahlen durchgeführt. Was die Unterschiedlichkeit der indischen Demokratie begründet, sind ihre demographischen und sozialen Dimensionen. Vom schieren Umfang her ist sie anders als alle anderen Demokratien der Welt. Von Anfang an war die Zahl der Wahlberechtigten doppelt so groß wie die der nächstgroßen – der Vereinigten Staaten. Heute ist sie mit etwa 700 Millionen mehr als fünfmal so groß. Bildet Indien hier den überragend hohen statistischen Gipfel, so steht es sehr weit unten, was Armut und Analphabetismus betrifft. Im Augenblick der Unabhängigkeit konnten nur zwölf Prozent der Bevölkerung lesen und schreiben. Vergleichszahlen wären 72 Prozent für Jamaika, 63 Prozent für Sri Lanka, vierzig Prozent für das damalige Malaya. Was die Armut angeht, so liegt das Pro-Kopf-Einkommen in Indien heute bei nur einem Sechstel dessen von Malaysia, einem Drittel dessen von Jamaika und nicht mehr als der Hälfte dessen von Sri Lanka. Diese Zahlen sind es, welche die Demokratie Indiens zu einem so bemerkenswerten Phänomen machen, und der Stolz seiner Bürger ist berechtigt. Was beeindruckend ist, ist deshalb noch kein Wunder – als welches die Inder und andere das politische System regelmäßig beschreiben, welches sich nach der Unabhängigkeit herauskristallisierte. Es war nie etwas Übernatürliches daran; irdische Erklärungen reichen völlig aus. Die Stabilität der indischen Demokratie rührte zunächst von den Bedingungen her, unter welchen das Land unabhängig wurde. Es gab keinen gewaltsamen Sturz der britischen Herrschaft; diese übergab die Macht an die Kongreßpartei als ihren Nachfolger. Die koloniale Bürokratie und Armee blieben intakt – abzüglich der Kolonisatoren. Mitte der dreißiger Jahre erklärte Nehru, der damals die Bürokratie – den Indian Civil Service – als „neither Indian, nor civil, nor a service“ beschimpfte, es sei „unabdingbar, daß der ICS und ähnliche Organisationen verschwinden“. Im Jahre 1947 waren derartige Forderungen ebenso vollständig verhallt wie seine Versprechungen, Indien würde niemals ein Dominium. Das Stahlgerüst des ICS blieb unberührt stehen, wo es war.
(…)
Schranken der Freiheit
Warum hat dann der schiere Druck der ausgehungerten Massen, die eigentlich an den Wahlurnen eine Machtposition erobern könnten, nicht zu einer Explosion von Forderungen nach sozialer Wiedergutmachung geführt, die mit den kapitalistischen Rahmenbedingungen dieser (wie jeder anderen) liberalen Demokratie unvereinbar gewesen wären? Gewiß nicht deshalb, weil sich der Kongreß jemals angestrengt hätte, auch nur bescheidene Schritte zu sozialer Gleichheit oder Gerechtigkeit zu tun. Die Chronik von Nehrus Regime, dessen Prioritäten die industrielle Entwicklung und das Wachstum des Militärbudgets waren, ist bar jeglichen Impulses in eine solche Richtung. Keinerlei erwähnenswerte Landreform wurde versucht. Eine Einkommensteuer wurde erst 1961 eingeführt. Die Grundschulbildung wurde völlig vernachlässigt. Als Partei wurde der Kongreß von reichen Bauern, Kaufleuten und städtischen Freiberuflern beherrscht, und das Gewicht der Agrarbosse war das größte; die Parteipolitik spiegelte die Interessen dieser Gruppen wider, denen das Schicksal der Armen gleichgültig war. Dafür wurde die Partei bei den Wahlen aber nie bestraft. Wieso nicht?
Die Antwort liegt – schon immer – in jenem Umstand, der Indien ebenfalls von allen anderen Ländern der Welt unterscheidet: den historischen Besonderheiten seiner sozialen Schichtung. Strukturell besitzen ausnahmslos alle herrschenden Klassen aufgrund ihrer geringeren Zahl und größeren Möglichkeiten einen Vorteil gegenüber den Beherrschten, was die Möglichkeiten des kollektiven Handelns angeht. Ihre Kommunikationswege sind kürzer; ihr Reichtum bietet ein universelles Medium der Macht, das sich in alle erdenklichen Formen der Dominanz umsetzen läßt; ihr Informationssystem kann die politische Landschaft aus größerer Höhe beobachten. Die untergeordneten Klassen – zahlreicher, stärker zerstreut, materiell schlechter ausgerüstet, kulturell schwächer bewaffnet – werden in der Regel immer von denen droben „organisatorisch überflügelt“. Nirgendwo ist diese allgemeine Struktur je stärker ausgeprägt gewesen als in Indien. Dort teilt sich das Land in etwa dreißig hauptsächliche Sprachgruppen auf, die unter dem Gesims der Kolonialsprache nebeneinander existieren; diese ist die einzige, in der verfassungsrechtliche Entscheidungen zugänglich sind, und höchstens ein Zehntel der Bevölkerung beherrscht sie leidlich. Bereits das wären beachtliche Hindernisse für jede landesweite Koordination der Armen.
Doch die wahrhaft tiefreichenden Hindernisse für jede kollektive Aktion (selbst innerhalb einer Sprachgemeinschaft, ganz abgesehen von übergreifenden Versuchen) stellten stets die unüberbrückbaren Gräben des Kastenwesens dar. Erblich, hierarchisch, berufsgebunden, durch und durch mit Phobien und Tabus aufgeladen, zerriß diese soziale Organisationsform des Hinduismus die Bevölkerung in etwa 5 000 jatis, von denen nur wenige eine einheitliche Definition oder Position im ganzen Land haben. Kein anderes System der Ungleichheit war je derart extrem – es scheidet nicht lediglich wie in den meisten anderen Fällen den Adel vom gemeinen Mann, die Reichen von den Armen, den Händler vom Bauern, den Gelehrten vom Unwissenden; es scheidet die Reinen von den Unreinen, die Sichtbaren von den Unsichtbaren, die Dürftigen von den Elenden, die Elenden von den Untermenschen –; und in keinem anderen formt die Macht der Religion mit solch gewaltiger Prägekraft die menschlichen Erwartungen.
(…)
Kabinett der Schranzen
Der schlimmste Zug des Regimes war weniger diese Zentrifugalität als die Entwicklung eines Hofs von Schranzen und Schmeichlern außerhalb des Kabinetts. Im Gegensatz zu Gandhi war Nehru ein schlechter Menschenkenner, und seine Wahl von Vertrauten stellte sich stets als katastrophal heraus. Über die Köpfe der führenden Offiziere hinweg machte er seinen Komplizen beim Sturz Abdullahs, B. N. Kaul, zum Chef des Generalstabs, einen grotesken Hasenfuß aus Kaschmir ohne Erfahrung im Einsatz, der bei der ersten Gelegenheit davonlief; insofern war Nehru direkt für das militärische Debakel des Jahres 1962 verantwortlich. Als persönlichen Sekretär hielt er sich einen widerlichen alten Bekannten aus Kerala, M. O. Mathai, der zu unglaublicher Macht gelangte, mit Nehrus Tochter ins Bett ging und das Aktenmaterial seines Büros an die CIA weiterreichte, bis sein Ruf so abstoßend wurde, daß Nehru sich widerwillig von ihm trennen mußte. Bei politischen Operationen in Kaschmir, im Nordosten oder auch in größerer Nähe verließ er sich auf einen brutal-unterbelichteten Polizeimann, Bhola Nath Mullik, einst in Diensten der Briten, nun Oberhaupt des Nachrichtendienstes. Der einzige Kabinettskollege, dem er vertraute, war Krishna Menon, ein inkompetenter Schwätzer, der mit Kaul zusammen schmählich unterging.
Trotzdem könnte man sagen, daß solche Defekte wenig zählten angesichts einer einzigen herausragenden Leistung. Nehrus Größe, so wird es allgemein empfunden, lag darin, daß er in einer nichtwestlichen Welt, wo es von Diktatoren wimmelte, als Demokrat regierte. Als Lehrer seiner Nation gab er ein Beispiel, von dem die nach ihm Kommenden lange Zeit nicht abweichen konnten. Von ihm angeleitet, fand sich die indische Demokratie, und sie hat seither auch überdauert. Daß Nehru seiner Überzeugung nach ein liberaler Demokrat war, ist offensichtlich. Und er hing den Prinzipien der parlamentarischen Regierungsform nicht bloß theoretisch an. Als Premierminister erfüllte er seine Pflichten in der Lok Sabha mit einer sorgfältigen Pünktlichkeit, die viele westliche Regierende beschämen konnte, sprach regelmäßig in der Kammer und nahm an den Debatten teil. Er fälschte niemals nationale Wahlen und unterdrückte nie das breite Spektrum der Meinungen. Dies alles ist unbestreitbar. Aber der Liberalismus ist ein Metall, das selten in reiner Form vorkommt. Nehru war vor allem anderen ein indischer Nationalist, und wo der Volkswille nicht mit dem national Notwendigen zusammenfiel, wie er es sich vorstellte, unterdrückte er ihn bedenkenlos. Dann waren die Instrumente der Regierung eben nicht mehr die Wahlzettel, sondern – eine Formulierung, bei der er sich selbst ertappen ließ – die Bajonette.
(…)
Irland, Israel, Indien
In der Geschichte der nationalistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert gibt es eine deutlich abgrenzbare Untergruppe, in der die Religion von Anfang an eine entscheidende Rolle bei der Organisation gespielt hat – sie lieferte sozusagen den genetischen Code der Bewegung. Die bedeutendsten Fälle sind jene, die schließlich stabile parlamentarische Demokratien begründet haben; die drei führenden Staaten dieses Typs sind heute auf der Welt Irland, Israel und Indien. In allen drei Fällen haben sich die nationalistischen Parteien, die nach der Unabhängigkeit an die Macht kamen – Fine Gael, Mapai, der Kongreß –, von der religiösen Unterströmung der Kampfzeit distanziert, ohne daß sie je in der Lage gewesen wären, sich mit diesem Erbe offen auseinanderzusetzen. In allen Fällen wurde die Regierungspartei, nachdem sie langsam an Strahlkraft verloren hatte, von einer extremeren Rivalin überholt, die weniger Skrupel hatte, an die vom ursprünglichen Kampf ausgelösten religiösen Leidenschaften zu appellieren: Fianna Fáil, Likud, BJP. Der Erfolg dieser anderen Parteien hing nicht nur mit der nachlassenden Energie der ersten Amtsinhaber zusammen, sondern mit der Fähigkeit der Überholer, das offen auszusprechen, was latent immer in der nationalen Bewegung vorhanden gewesen war, aber weder eingestanden noch strikt abgelehnt wurde. Sie konnten mit einer gewissen Berechtigung behaupten, sie seien die legitimen Erben der ursprünglichen Sache. In allen Fällen spielte sich dieses Manöver in einem parlamentarischen System ab, in dem sie verfassungskonform operierten (wenn auch in jedem Fall mit gewissen Vorkriegssympathien für den Faschismus). Jabotinsky, der Begründer der zum Likud führenden Entwicklungslinie, war ein Bewunderer Mussolinis; die RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), jene Organisation, auf welcher die BJP aufbaute, orientierte sich am Nationalsozialismus.
Weder der institutionelle Katholizismus von de Valeras Irland noch der konstitutionelle Judaismus des zionistischen Staates, den Ben-Gurion konstruiert hatte, fand seine Entsprechung in Indien, wo der Staat niemals ein derart explizites Bündnis mit der Religion schloß. Historisch gesehen war aber kein führendes Mitglied der Kongreßpartei in der Lage gewesen, den Pietismus Gandhis offen und entschieden zu bekämpfen – alle waren überzeugt, daß seine emotionale Wirkung durch die Mobilisierung der Massengefühle einen entscheidenden Vorteil im Kampf für die Unabhängigkeit bot. Nach der Unabhängigkeit kamen Gandhis doktrinäre Überzeugungen ins Museum, aber daß er die Politik mit hinduistischem Pathos durchtränkt hatte, das lebte weiter. Über zwei Generationen hinweg (wie in Israel) konnte der kompromittierte Ursprung des Staates vom Charisma eines Premierministers verdeckt werden, dem an Aberglauben irgendwelcher Art wenig, viel dagegen an einer vom Staat gelenkten wirtschaftlichen Entwicklung gelegen war. Nachdem er gestorben war – mit kompletten Hindu-Bestattungsriten einschließlich des Verstreuens der Asche im Ganges – fand eine rasche Verschlechterung statt. Man könnte sagen, daß Nehru in dieser Hinsicht ein übleres Erbe hinterließ als Ben-Gurion, da er ein zusätzliches irrationales Element in die Politik einführte: das Blut, und durch die Erschaffung einer politischen Dynastie einen weiteren Fluch aussprach, der endlos auf Indien lastet. Die Tochter betonte charakteristischerweise den Säkularismus stärker und ließ eine verspätete säkularistische Verpflichtung zum ersten Mal auch in die Verfassung schreiben, obwohl sie in der Praxis stets mit dem Instrument des religiösen Appells flirtete. Als dann der Enkel an der Macht war, war die globale Bewegung in Richtung Neoliberalismus in vollem Gange, und die indische Mittelschicht wollte nur zu gerne davon profitieren. Unter diesen Bedingungen war der Boden für den Auftritt der BJP vorbereitet, die nun im Stil des Likud ihr Erbe antrat. In allen drei Ländern beruhte das politische System schließlich auf einem mehr oder weniger regelmäßigen Regierungswechsel zwischen zwei großen, miteinander verwandten Parteien, die sich um Koalitionen mit diversen opportunistischen kleineren Organisationen bemühten, um Mehrheiten zu erreichen, die sie alleine nicht mehr erzielen konnten – das ist das gemeinsame Muster des Dáil, der Knesset und der Lok Sabha. In allen dreien ist die Marginalisierung der Linken eine strukturelle Folge der dominanten Bedeutung einer hegemonialen Religion für die nationale Identität.
(…)
Der Käfig der Demokratie
Was die indische Blockade spiegelt, ist der politische Widerspruch im Herzen des Systems – der Widerspruch zwischen, wie Zoya Hasan es konzise formuliert hat, „der Frustration der Bevölkerungsmehrheit über Regierungen, die sie gewählt hat, aber nicht kontrolliert, und der selbstgefälligen Gleichgültigkeit der Elite und der Mittelschicht Regierungen gegenüber, welche sie nicht wählen, aber kontrollieren“. Letztere befürworten die neoliberalen Rezepturen. Die ersteren aber verhindern immer noch einen allzu provokativen Abbau der Einrichtungen eines früheren, stärker paternalistischen Systems. Schlimmer noch (vom Standpunkt der Börse gesehen und der Technokraten auf der Suche nach weiterer Liberalisierung): Die Gesetzgebung läßt sich nicht vollkommen vom Druck einer riesigen, im Elend lebenden Wahlbevölkerung isolieren. Im Jahr 2005, als die Kongreßpartei für ihre Mehrheit noch die kommunistischen Stimmen brauchte, wurde ein „Gesetz über garantierte Arbeit auf dem Land“ (der National Rural Employment Guarantee Act oder NREGA) verabschiedet, welches jedem Haushalt in den ländlichen Regionen jährlich hundert Tage bezahlter Arbeit zum gesetzlichen Mindestlohn sicherte, wobei mindestens ein Drittel dieser Arbeitsplätze für Frauen reserviert blieb. Es handelt sich um bezahlte Arbeit und nicht wie in Brasilien um eine direkte Zahlung, um möglichst die Gefahr zu vermeiden, daß das Geld an irgend jemanden geht, der nicht zu den Armen zählt, und um sicherzustellen, daß es nur die erreicht, die auch bereit sind, zu arbeiten. Von allen treuen Gemütern kritisiert als eine die Wirtschaft schwächende Wohlfahrtsmaßnahme hinter der Fassade überflüssiger Arbeitsprojekte, wurde das Gesetz von der Mittelklasse „wie ein nasser Hund bei einer Glamourparty“ begrüßt (mit den Worten eines seiner Architekten, des belgisch-indischen Ökonomen Jean Drèze). Im Gegensatz zu der Bolsa Família in Brasilien blieb die Anwendung des NREGA den Einzelstaaten überlassen, so daß seine Umsetzung sehr ungleichmäßig und unvollständig war – mit Löhnen, die häufig unter dem gesetzlichen Minimum lagen, für Arbeit, die es oft nur für weniger als hundert Tage gab. Die durchgeführten Arbeiten sind nicht immer produktiv, und wie bei allen sozialen Programmen in Indien werden die Mittel manchmal auf lokaler Ebene von der Korruption abgeschöpft.
(…)
Wenn die Armen uneins bleiben und die Arbeiter verstreut und schlecht organisiert sind, wie steht es dann mit anderen Kräften der Opposition innerhalb des politischen Systems? Die neue Mittelschicht hat sich zwar gegen die Megakorruption gewandt, doch ist sie ihrerseits kaum dem Augenzwinkern und dem Briefumschlag abgeneigt, zu schweigen von Gefälligkeiten für die Verwandtschaft. Einer Kultur des Zelebritätenkults und des Konsums verfallen, die in vielen der Medien ihre spektakuläre Leere demonstriert, und sich dabei allem Anschein nach in kollektivem Egoismus verhärtend, kann diese Mittelschicht kein Ferment für die soziale Ordnung sein. Mit der Intelligenz steht es anders. Hier besitzt Indien Köpfe von einer Vielfalt und Qualität wie vermutlich kein anderes Entwicklungsland der Welt und wie nicht viele entwickelte Länder. Diese Intellektuellen sie bilden eine vernetzte Gemeinschaft von beeindruckender Klugheit und Distinktion. In welcher Beziehung stehen sie zu Indien? Intellektuelle gelten vielerorts – was ganz irrig ist – als prinzipiell kritisch. Aber in manchen Gesellschaften hat man dieses Mißverständnis als Selbstbild oder Erwartung verinnerlicht, und das trifft auch für die meisten indischen Intellektuellen zu. Inwieweit lösen sie diese Erwartung ein?
Verallgemeinerungen sind zwangsläufig falsch. Aber eine ungefähre Einschätzung ist vielleicht möglich. Klar ist, daß die Haltungen sich je nach den Themen unterscheiden, entlang einer Kurve, die ihre eigene Logik hat. Soweit es um die indische Gesellschaft allgemein geht, kann man mit Sicherheit sagen, daß es einen überwältigend großen Konsensus der Kritik gibt. Es fiele schwer, einen sozialen Mißstand oder eine Ungerechtigkeit zu benennen, die nicht schonungsloser Betrachtung unterzogen worden ist. Hunger, Elend, Analphabetismus, alle erdenklichen Rechtsbrüche, sexuelle Diskriminierung, ökonomische Ausbeutung, Korruption, Kommerzialisierung, Fanatismus, sich ausbreitende Slums, Ausplünderung der Umwelt – eine detaillierte Gelehrsamkeit des Zorns und des Ekels hat sich mit alledem befaßt. Die leidenschaftliche Anklage gegen viele dieser Züge (sie erstreckt sich auch auf Indiens Beanspruchung des Großmachtstatus) des eminent kritischen Liberalen Ramachandra Guha, der Indiens führender Zeitgeschichtler ist, bezeugt eine von vielen geteilte Sensibilität für diese Probleme.
Die Gesellschaft ist das eine, die Politik ist – wenn auch niemals getrennt von der Gesellschaft – etwas anderes. Wie steht es mit dem Anspruch der „Idee Indiens“, dessen, was man auch die indische Ideologie nennen könnte – den dreieinigen Werten von „Demokratie“, „Säkularität“ und „Einheit“? Hier verändert sich die Atmosphäre. Doch lauten die Antworten nicht in allen drei Fällen gleich; der kritische Quotient ist verschieden. Die indische Demokratie – die so oft rituell bekränzt wird wie ein lokales Götterbild, als sei sie ein Wunder in sich – wird insgesamt mit viel weniger Aberglauben behandelt, als die öffentlichen Rituale erwarten ließen.