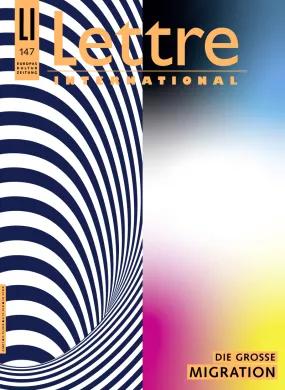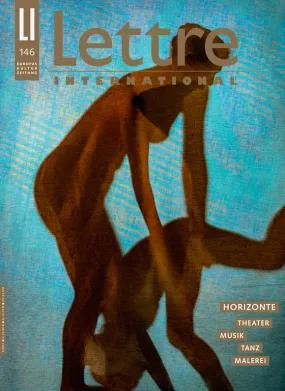LI 56, Frühjahr 2002
Walroßsuppe, Seehundblut
Die Kultur der Inuit - ein Ethnographenleben im ewigen EisElementardaten
Genre: Bericht / Report, Gespräch / Interview
Übersetzung: Aus dem Französischen von Jan Borm
Textauszug
(...) Jan Borm: Wie konnten Sie während der Polarnacht eine Strecke von 500 Kilometern bewältigen? Wie haben Sie sich angepaßt?
Jean Malaurie: Ich bin ziemlich ungeschickt. Das mag Sie überraschen: Ich bin kein Bastler. Aber so unpraktisch wie in meinem Pariser Alltag kann ich nun auch wieder nicht sein, sonst hätte ich in solchen Breitengraden nicht überleben können. Als ein Mensch der westlichen Welt und wie ein verwöhntes Kind hätte ich versucht sein können, mir helfen zu lassen, aber die Inuit waren es, die mich erzogen haben. Aus Notwendigkeit hat sich diese Bastlerkapazität in mir entpuppt, die ich sonst wirklich nicht habe.
Ich hatte 13 Hunde, denn ich wollte wie die Inuit sein; ich hatte einen Schlitten, war gekleidet wie sie, aß wie sie; so wollte ich sie für meine Unternehmungen gewinnen. Wie sie zu leiden, das war die Bedingung für meine Aufnahme. Ein Eskimo „hilft nicht" – zumal ich sie nur für bestimmte Aufgaben, nie im Alltag und schon gar nicht für ihre Zusammenarbeit bei meinen Stammbuchforschungen bezahlte. Für sie war ich ihr Gast. Ich war ihrem Blick ausgesetzt.
Die Gruppe forderte mich schweigend auf, wie sie vorzugehen. Tag für Tag sanken die Temperaturen ab: minus 15, minus 20, minus 40, minus 50 und bei Schneestürmen bis zu minus 60 Grad. Ein Winterlager zu finden, die Peitsche zu schwingen, die Hunde mit Seehundstücken zu füttern, das Gespann und die Alltagsausrüstung zu prüfen: Schuhe, Handschuhe. Ich merkte sehr bald, daß mein Gerät ungeeignet war. Meine sogenannten Bergstiefel froren in der Nacht so fest, daß ich frühmorgens die Rindslederhaut nicht auftauen konnte. Ich habe mich also an ihre kamiks gewöhnt, diese doppelt beschichteten Stiefel aus Seehundfell außen und Hunde- oder Hasenfell innen. Sie sind sehr schmiegsam und recht leicht. Morgens muß man sie selber kauen, sofern man keine Frau hat, die das für einen tun kann.
Auch an ihre Hosen aus Eisbärfell und ihre Rentierfelljacken habe ich mich gewöhnt. Ich aß wie sie außer Fleischbrühe mit Seehund oder Walroßblut kiviak (Das sind Alken, Meeresvögel, die man in einen Seehunddarm einlegt, damit sie sich langsam zersetzen; man leckt das Fett von ihrer Haut ab). Zu harte Stücke spuckte ich auf den Boden, ich schneuzte mich in meine Hände und wusch mich nur, wenn unbedingt nötig. Allerdings rasierte ich mich regelmäßig, um wie sie auszusehen – denn sie sind bartlos (sie zupfen ihre Barthaare) –, und nicht wie ein Entdecker oder Missionar.
Auf der Inuitschule
Komplett eintauchen. Ich ließ nicht locker: die Hunde zu lenken, sie zu füttern, von den Inuit geschätzt, ja gern gehabt zu werden; die ironischen Bemerkungen von einigen zu ertragen, sich auf einer Piste anhand der Sterne zu orientieren, ohne Kompaß – diese Gegend ist eine der magnetischsten überhaupt, der geomagnetische Pol ist nicht weit –, wie auch auf Packeis oder Gletschern in 1500 Meter Höhe, mitten in der Polarnacht; und im Iglu, Tag für Tag, jeden Abend sich zu unterhalten, zu lachen, die Kälte auszuhalten. Meine Hartnäckigkeit hat sie erstaunt, und somit haben sie mich langsam, aber sicher in ihre Gruppe aufgenommen.
Außerdem beherrschte ich ihre Sprache jede Woche besser. Jeden Tag lernte ich zehn neue Vokabeln. Ich heftete diese Wörter auf Zetteln mit Wäscheklammern an eine Leine, die quer durch meinen Wohnraum hing, um sie auswendig zu lernen. Wann immer ich einen Eskimo traf, stellte ich diese Wörter zu Sätzen zusammen. Nach und nach beteiligten sie sich humorvoll an meiner Ausbildung, indem sie „mein" Inuktitut sprachen, einschließlich meiner Grammatikfehler und der betont französischen Aussprache, die meine Inuitbekannten alle aus Höflichkeit imitierten, um sich mit mir zu unterhalten.
Somit entstand dank ihrer aktiven Unterstützung ein Abriß ihrer Ahnengenealogie. Ich habe 1 500 Namen aufgeschrieben. Die Bevölkerung war von dieser Arbeit begeistert, vor allem die Frauen. Ihre Verwandtschaftsbeziehungen waren kompliziert. Ehen wurden unter Blutsverwandten bis in den 5. Grad vermieden. Ein junger Mann im Alter von 18 bis 25 konnte nur unter zwei oder drei Frauen wählen. Der Stammbaum entstand während meiner Reisen von Dorf zu Dorf, quer durch die Polarnacht. Ich entdeckte dabei Tendenzen ihrer Verwandtschaftsstruktur.
Diese Arbeit verlangte rasche Fortschritte meiner Sprachkenntnisse, denn sie hörten ungern die Namen ihrer Verstorbenen – den Namen der Inuit wohnt nämlich eine Macht inne, und sie waren nicht bereit, diese mehrmals auszusprechen. Hätte ich mich beim Wiederholen des Namens geirrt, hätte ich einem Mischvetter oder einer Urgroßmutter väterlicherseits den falschen Namen gegeben, wäre ich Gefahr gelaufen, das bißchen Ansehen, das ich als ilisimatork – das heißt, als Wissenschaftler – hatte gewinnen können, zu verlieren und nichts anderes als ein weißer Nichtsnutz zu sein.
Ich muß daran erinnern, daß die Inuit nicht die geringste Achtung für uns hegen. Wie gesagt, die Expeditionen, die meiner vorausgingen, waren von Meutereien und Katastrophen begleitet, und die Inuit haben erkannt, wie schlecht es einige meiner Vorgänger verstanden, sich der Gegend anzupassen. „Sie haben Bücher, aber nicht viel im Kopf, zumindest manche nicht." Diese den Entdeckern entgegensetzte Sicht der Inuit habe ich ausführlich in Ultima Thule geschildert.
Einige große Figuren verlieren nach weiteren Recherchen in unveröffentlichten Dokumenten der Archive in Washington, im British Museum und in Kopenhagen ihren Denkmalstatus. Die Entdecker des Pols, die ersten „Kolonialisten"also, haben „sie" überhaupt nicht beeindruckt; kein bißchen, trotz der mächtigen technischen Mittel, über die sie verfügten.
Und dennoch sprechen Sie vom Empfang bei den Inuit als einer „Lektion der Toleranz".
Das ist leicht gesagt! In Wirklichkeit waren die Inuit die ganzen 14 Monate lang bestrebt, aus mir Nutzen zu ziehen. Es freute sie zu sehen, wie der Stammbaum vorankam. Sie hörten mir gerne zu. Sie liebten das Leben und zerstreuten sich mit Hilfe ihres Erzähltalents. Aber auch ich sollte sie unterhalten, wenn auch nicht zu aufdringlich.
Trotz der liebenswerten Züge seiner Gesichtsmaske wird der Eskimo dazu erzogen, durch und durch hart zu sein. Er scheint zu lächeln, doch in Wirklichkeit ist er pragmatisch. Ich wollte aber nicht ihr Diener sein und wußte zugleich, daß ich diese über 500 Kilometer verstreuten Familien nicht hätte besuchen können, ohne ihnen meine Zusammenarbeit anzubieten.
Sollte ich Streit mit einer Familie oder einem Eskimo bekommen, so hätte ich Streit mit der ganzen Gruppe. Diese Menschen sind egalitäre Kommuneanarchisten, das heißt, untereinander solidarisch. Es gilt das Gesetz der Gruppe. Diese hat aber auch Gegner, Nörgler und Gewalttätige. Ja, manche hatten sogar gemordet. Ich kannte welche in meiner nächsten Umgebung. Strategisch gesehen mußte ich also mit dem einen und dem anderen ohne weitere Umstände auskommen, und zwar indem ich nach einer Reihe von persönlichen Erfahrungen ihr elitäres System des Teilens analysierte. Ich mußte regelrecht eine Graphik sehr komplexer psychologischer Beziehungen erstellen und Verbündete finden. Das ist eine komplizierte Angelegenheit.
Unter diesen Inuit gab es Personen, die mehr Ansehen hatten als andere, insbesondere einen Mann namens Uutaak. Er war 1909 Pearys Begleiter auf dem Weg zum Pol. Er hat sich bei unserer ersten Begegnung im Juli 1950 in Thule, wo er in einem bescheidenen Iglu lebte, auf Anhieb für mich interessiert. Das war mein Glück. Somit gehörte ich zu seiner Sippe. Sein Sohn, Kutsikitsoq, ist mein Freund geworden. Auf meinen Fahrten mit dem eigenen Hundeschlitten habe ich stets bemerkt, daß diese Tauschbeziehungen – do ut des – ausschlaggebend sind.
Mit dem Hundeschlitten loszuziehen bedeutet, gezwungen zu sein, in jedem Eskimolager über das lebensnotwendige Futter für mein Gespann zu verhandeln, denn ein Hund braucht alle 24 Stunden, spätestens nach 48 Stunden, zwei bis drei Kilo Fleisch und Fett. Ein Eskimodorf ist keine Tankstelle. Sie können nicht gleich nach Ihrer Ankunft auf die Jagd gehen, denn Sie sind dort, um die Alten und ihre Frauen-Informantinnen diskret zu befragen. Ich mußte also mit diesem oder jenem verhandeln. Sie gestanden mir ihre Hilfe und zehn Kilo Fleisch für mich und die Tiere nur dann zu, wenn ihre Angehörigen den Eindruck hatten, daß sie von mir etwas erhalten könnten.
Diese freundschaftlichen Tauschbeziehungen erforderten also regelrechte geographische Kenntnisse dieser verschiedenen Beziehungen, die oft unausgesprochen waren. Mein Freund Kutsikitsoq war darin ein Meister: „Ich leih dir was, gib mir was. Wie das Gesetz es verlangt." Ich fand meinen Platz in einem ausgeprägten Netzwerk. Dank dieses Alltags fing ich an, die Inuit besser zu verstehen, über das hinaus, was ich über sie in Büchern gelesen hatte. Es gibt Dinge, die man gelesen hat, und andere, die man erlebt hat. Das ist nicht das gleiche. Ach, die Gelehrten! ad usum delphini …
Spielen Frauen nicht die Schlüsselrolle in der Gesellschaft der Inuit?
Sie haben die Macht. Sex ist keines ihrer Hauptanliegen, sondern eher eine banale Alltagsangelegenheit. Ihr Hauptinteresse gilt der Lebensqualität. Zu den geschätzten Eigenschaften eines Mannes rechnet man nicht nur seine Fähigkeit, erfolgreich bei der Jagd zu sein. Auch sein Maskenspiel gehört dazu, seine Freizügigkeit, die allerdings nicht großtuerisch sein darf, seine Loyalität, sein Mut, sein Frohsinn, sein erfinderischer Sinn, um der Gruppe von Nutzen zu sein.
Ich erinnere daran, daß dieses Volk Langeweile verabscheut. Sie haben zum Beispiel der Zigarette einen besonderen Namen gegeben: „Die, mit der man die Zeit vertreibt". Meine bloße Anwesenheit war natürlich eine Art von Zerstreuung, die ich dank meiner Erzählkünste zu pflegen wußte. Ihre Kunst zu leben habe ich zusammen mit ihnen erlernt: kommunizieren; sagen, wer man ist und was man gesehen hat. Teilen.
(...)