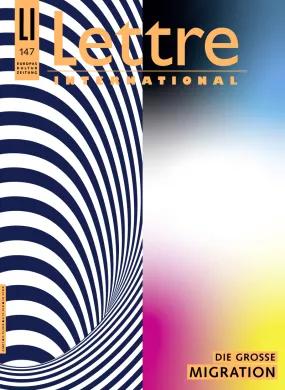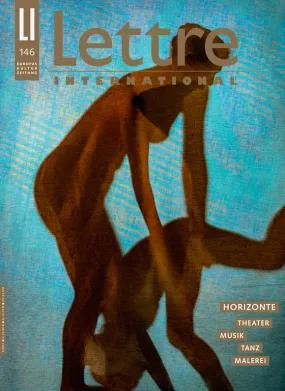LI 91, Winter 2010
Orte, Blicke, Bilder
Die Kunst des Dokumentarfilms oder vom Umgang mit der WeltElementardaten
Genre: Gespräch / Interview
Übersetzung: Aus dem Französischen von Esther von den Osten
Textauszug
(Auszug/LI 91)
(...) OLIVIER MONGIN: Was unterscheidet Ihrer Ansicht nach den Dokumentarfilm von der Fiktion?
STÉPHANE BRETON: Im Dokumentarfilm sammelt man ein, was da ist; man macht eine Erzählung aus Stücken, die bereits vorhanden sind und denen man keine vorgefaßte Idee aufzwingen will. Der Dreh ist objektiv, dem Unvorhersehbaren überlassen – das ist das, was man direct cinema nennt. In der Fiktion macht man eine Erzählung aus Stücken, die man nach einer im voraus festgelegten Idee fabriziert. Das ist zwangsläufig erhabener als der Dokumentarfilm, totaler, breiter; aber es ist manchmal viel weniger schön, viel weniger wahr. Die schönsten Augenblicke des Dokumentarfilms kommen den schönsten Augenblicken bei Tarkowskij, Bergman, Fellini gleich; sie haben nur den Nachteil, daß sie diskreter sind, bescheidener. Doch ich möchte Ihnen meine eigene Definition des Dokumentarfilms geben. Das ist mehr oder weniger metaphorisch zu verstehen: Der Dokumentarfilm ist ein Film, in dem man unmöglich einen Kuß sehen kann. Warum? Weil der Kuß eine private Handlung ist und normalerweise nicht vor einem Dritten gezeigt wird. Aber beim Dokumentarfilm ist die Kamera oder, wenn Sie so wollen, der Film immer in der Position des Dritten. Das ist sie in der Fiktion nie. Die Fiktion liefert einen Blickpunkt, der das semiotische Recht hat, dazusein, wie die Fliege, selbst wenn die Kamera eine semiotische Unmöglichkeit ist: wenn man zum Beispiel Milady filmt, die sich ein Stück Huhn in die Kehle schiebt, das ihr ein Grauer Musketier ausgehändigt hat. Ich habe als Kind oft an Miladys Kehle gedacht. Aber man stellt sich keinen Dokumentar-film im Jahrhundert von Ludwig XIII. vor. Das wäre ein grammatikalischer Unsinn. Kurz: Den Dokumentarfilm unterscheidet von der Fiktion, daß der Dokumentarfilm den Fakten zeitgleich ist, zumindest während des Drehs; daß die Schrift der Erzählung zeitgleich ist. Und sagen wir, daß man sich im allgemeinen nicht vor einem Unbekannten küßt. Also ist der Kuß das, was man in einem Dokumentarfilm nicht sehen wird. Das bedeutet, daß der Dokumentarfilm seine eigenen Grenzen definiert, die nicht technisch, sondern ethisch sind: Er hat immer eine genaue Vorstellung von der Indiskretion, die er nicht begehen darf. Ein Gegenbeispiel: In Faits divers (1982) folgt Raymond Depardon einer Mannschaft vom Polizeinotruf und ist mit einem Mal dabei, einen Mann zu filmen, der auf seinem Bett liegt. Er erfährt, daß dieser Mann tot ist. Aus Takt, aus Scheu wendet er die Kamera ab. Jeder möchte rufen: Zu spät! Er glaubte, er habe das Recht zu filmen, und merkt, daß er indiskret gewesen ist. Er bereut es bitter. Das ist eine Naivität, die aus dem Allmachtsgefühl des Journalisten von Gottes Gnaden entsteht, der sich in der Illusion wiegt, ihn verbinde mit der Wahrheit eine Wahlverwandtschaft. Der Journalist posaunt, er habe das Recht, uns zu informieren; der Dokumentarfilmer gesteht ein, daß er nur das Recht hat, uns zu zeigen, was man ihm zu sehen gestattet hat. Ein Journalist ist bereit, die Agonie eines Menschen zu filmen, weil er die ethische Verantwortung nicht kennt, die sich aus der Tatsache ergibt, daß er anwe-send ist. Einem Dokumentarfilmer würde sich der Magen umdrehen; denn eine Agonie filmen heißt, einen Menschen ganz allein abkratzen zu lassen. Ein fiktionaler Film dagegen kann den Tod filmen, und niemand wird es ihm vorwerfen, denn der Tod ist vorgetäuscht. Wenn Godard sagt, travelling sei eine moralische Angelegenheit, dann trifft das auf den Dokumentarfilm vollkommen zu.
Man kann also nicht alles filmen – und auch nicht auf jede beliebige Weise.
In dieser Hinsicht ist das pornographische Kino semiotisch anregend, denn es ist weder Dokumentarfilm noch Fiktion. Die Pornographie zeigt das Reale, aber ein gespieltes Reales – und vor allem kein simuliertes, sonst läge da keinerlei Interesse drin. Noch einmal: Man muß dem Bild glauben können, wenn es seine Rolle spielen soll. Der pornographische Film läuft auf dieselbe Faszination hinaus wie jene, die das Schauspiel der Welt gibt. Es ist nicht sonderlich gewagt zu sagen, daß die Pornographie den Schlüssel zur Faszination am Bild überhaupt liefert.
In Ihrem ersten Film, Eux et moi, gewinnt diese Frage des Blicks eine besondere Bedeutung, denn der Film besteht darin, Leute zu filmen, die Sie anblicken.
Der Film erzählt mit subjektiver Kamera von den dornigen und witzigen Beziehungen mit den Leuten aus dem Dorf in Neuguinea, in dem ich meine ethnographische Feldforschung gemacht habe. Er beschreibt den Kubikmeter Raum zwischen ihnen und mir, in dem Tabak, Geld, Nahrung, Handschläge – Blicke eben – ausgetauscht werden. Das Geld spielt eine wichtige Rolle, denn es handelt sich um eine monetäre Gesellschaft, wie die melanesischen Gesellschaften allgemein, und das Muschelgeld ist dort die gemeinsame Sache schlechthin, die res publica, Gegenstand aller Gespräche und aller Unternehmungen. Das dürften alle Ethnologen wissen. Aber der Film wollte diese ein bißchen rütteln und daran erinnern, daß ein Feldethnologe nicht wie ein Journalist ist; daß sein Daseinsrecht nicht am Firmament geschrieben steht und daß er, ehe er Theorie absondert, erst einmal in der Lage sein muß, vor Ort zu bleiben. Er hat den Fuß in die Tür gestellt; jetzt muß er lernen, sich anerkennen zu lassen. Das ist nur möglich, indem er die Ärmel hochkrempelt und mitmacht, am sozialen Austausch teilnimmt. Der Feldethnologe beginnt in einer Position der Inferiorität; sein Ziel ist jetzt, am Spiel teilzunehmen – das ist ein wenig wie eine Zwangsheirat, die als Liebesgeschichte endet. Davon spricht der Film. Aber diese Schwierigkeit, da zu sein, die ist eben dieselbe für den Dokumentarfilmer. Die Position ist dieselbe.
Ist Ihnen deshalb die Idee der subjektiven Kamera gekommen?
Selbstverständlich. Ich denke, der Ethnologe und der Filmer haben nur dann das Recht, zu schauen – oder es gelingt ihnen überhaupt nur dann –, wenn sie akzeptieren, daß man sie ebenfalls anschaut. Die Eingebung mit der subjektiven Kamera ist mir gekommen, weil ich das mittels des Filmes selbst erzählen wollte: Die Kamera überlagert sich meinen Augen, denn sie filmt in meiner Blickachse; zur selben Zeit nimmt sie die Blicke derer auf, die mich anschauen, so als wären sie ihr zugewandt. Der Film ist also im eigentlichen Sinne lebendig, denn er ist genau ein Blick. Nichts ist komischer, als den Blick der Leute anzuschauen, die Sie anschauen.
Der zur Kamera gewandte Blick kennzeichnet Ihren Stil.
Jedesmal versuche ich auf unterschiedliche Weise – mal mehr, mal weniger intensiv –, allein über die Gegenwart der ihm zugewandten Blicke das Gefühl der Gegenwart des Filmemachers entstehen zu lassen. Ich frage mich, ob ich diese Sache nicht erfunden habe. Es gibt viele Dokumentarfilme, die mit subjektiver Kamera gedreht sind, die ich damals nicht gesehen hatte, zum Beispiel David Holzmans Tagebuch (Jim McBride, 1967) oder Shermans Feldzug (Ross McElwee, 1986), aber jedesmal kann der Regisseur es nicht lassen, vor die Kamera zu latschen, um seine Filmspule zu zeigen. Meiner Ansicht nach ist das eine unglückliche Entscheidung: Der Film spricht vom Regisseur, aber er kann kein Blick mehr sein. Ich verstecke mich lieber und lasse den Film ein selbständiges Wesen werden.
Der Kamerablick ist in der Fiktion seltener.
Ja, denn die grammatische Regel der Fiktion ist, daß die Kamera nicht existiert, sonst glaubt man nicht dran. Es ist genau das Gegenteil zum Dokumentarfilm, dem man nicht glaubt, so scheint mir, wenn man versucht, uns glauben zu machen, der Filmemacher sei nicht da. Der Kamerablick der Fiktion existiert nur als Blick auf die Vergangenheit: bei Fellini; als Jux über die Fiktion: bei Godard; als mise en abyme des Films: bei Bergman. Im Dokumentarfilm will der Kamerablick einfach sagen: Ich, der ich filme, bin präsent; was ich filme, ist also da. Der Kamerablick macht die Präsenz strahlend.
(...)