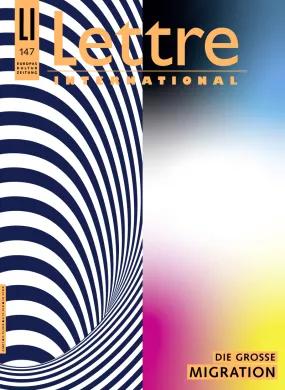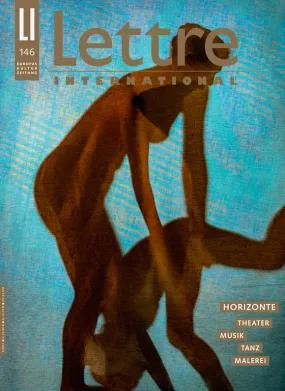LI 70, Herbst 2005
In Kolumbien
Eine Zivilbevölkerung zwischen Guerilla, Militär und DrogenmafiaElementardaten
Textauszug
Wir reisten in Uribes Heimatprovinz, in die wunderschöne Region von Uraba mit ihrem fruchtbaren Boden und den riesigen Bananenplantagen.
Die Finca Yacaren liegt nahe der Stadt Apartado. Die Arbeiter schwitzen in der Mittagshitze. Sie beugen sich über große Wannen voller Chemikalien und reinigen die grünen „Del Monte“-Bananen. Der Verwalter liegt mit seiner Sekretärin in der Hütte am Eingang der Finca und amüsiert sich, während Ramiro Llona und seine Mannschaft im Abschnitt 10 die Bananen ernten.
Man gibt uns den Rat, nicht allein durch die Reihen mit Bananenbäumen zu wandern, weil angeblich Rebellen in den Plantagen auf die Jagd gingen. Seit Jahren tobt ein Krieg in den unübersichtlichen Fincas zwischen der Guerilla und den Paramilitärs, jeden Monat erobert die eine oder die andere Seite einen Abschnitt, die Wege zwischen den Plantagen markieren Frontverläufe. In dem dunklen, feuchten Urwald aus Bananenstauden regiert nur noch das Chaos. Angeblich ist die Gewalt gerade über Yacaren hinweggezogen, angeblich herrscht Ruhe seit einigen Wochen.
Wer nicht muß, wagt sich trotzdem nicht ins Innere der Plantagen.
Wir gehen gleichwohl die Truppe um Ramiro Llona suchen.
Wir folgen einem Draht mit Stahlhaken und dringen immer tiefer in den Bananenwald vor. Der Abschnitt 10 erstreckt sich 50 Meter links und rechts dieses Drahtes, einer Zugkonstruktion, mit der die Bananen zum Eingang der Finca transportiert werden.
Es sind viele Kilometer mit Bananenbäumen, ein Labyrinth aus Grün und Blau (das Blau der Plastiktüten, mit denen die Fruchtansätze abgedeckt werden). Durch die Blätter dringt kein Sonnenlicht. Feuchtigkeit legt sich auf unsere Lungen und rinnt in kleinen Bächen den Körper hinunter.
Nach einer halben Stunde schließlich finden wir die Arbeiter. Es sind fünf Mann.
Sie haben die geschmeidigen Bewegungen jahrelanger Erfahrung, Zwölf-Stunden-Schichten sieben Tage die Woche haben jede Handlung, jeden Griff, jeden Schritt eingeschliffen und habitualisiert.
Alles geschieht schnell und wortlos: Ein, höchstens zwei Schläge mit der Machete, dann hat der erste die Bananenstaude vom Baum geschnitten. Sie fällt direkt auf das schwarze Gummikissen auf dem Rücken des zweiten Mannes, der die kostbare Fracht zu Ramiro trägt. Dieser befestigt sie an einem Haken der Seilbahn, eine Staude nach der anderen, und dann werden sie alle über mehrere hundert Meter nach draußen geschoben.
„Hier hat uns keine Polizei beschützt“, sagt er. „Wir waren auf uns selbst gestellt. Jetzt ist alles ruhig. Die Paras haben gegen die FARC gekämpft, sie haben sich zurückgezogen, jedenfalls vorerst. Wie lange die Ruhe anhält, weiß man nie.“
Die unbefestigte Straße zur Nachbarplantage – 148 Hektar mit „Banadex-Chiquita“-Bananen – war Guerillagebiet. Bis vor ein paar Wochen tobte auf diesen Feldern der Krieg zwischen Rebellen und rechtsgerichteten Paramilitärs. Viele Grundbesitzer sind in die Städte geflüchtet. Wann sie zurückkehren, weiß niemand. Vorerst werden die Plantagen von erfahrenen Verwaltern geleitet, von Leuten wie Carlos, technischer Leiter der „Banadex“-Farm. Fotos dürfen wir nicht machen, und bevor wir herumgeführt werden, belehrt uns der Direktor Alejandro über die sozialen Errungenschaften, die „Banadex“ für die Arbeiter eingeführt hat, sowie über die großen Verbesserungen im Qualitätsstandard der „Chiquita“-Bananen.
Es hört sich an, als spreche Carlos’ Chef immer über irgendwelche vergleichbaren Produkte, unabhängig davon, ob er gerade von seinen Angestellten oder seinen Bananen redet.
Anschließend zeigt Carlos uns das Anwesen und gibt uns eine Einführung in die Wissenschaft von vollkommenen Bananen und unvollkommenem Frieden: „Wer in Kolumbien Waffen besitzt, dem gehört auch das Gesetz“, sagt er, während er die Größe der Früchte mit dem calibrador überprüft und feststellt, ob sie die Norm für eine echte „Chiquita“-Banane erfüllen. „Wenn du am Leben bleiben willst, mußt du unparteiisch bleiben.“
Hier unterstützen alle Uribe und seinen Krieg gegen den Krieg.
Der Präsident solle Gewalt anwenden, um der Gewalt Einhalt zu gebieten – nur die Helden der Paramilitärs, die soll er nicht anrühren. Keine Klagen über die Brutalität der paramilitärischen Einheiten, über ihren illegalen Status, über die Willkür, mit der sie „Verräter“, „Rebellen“, „Aufrührer“ bestrafen, über ihre illegalen Landnahmen.
„Wenigstens haben sie der Region vorläufig Frieden gebracht“, sagt Modesto Restrepo Zapata. Der technische Zeichner lehnt am Tresen des Billardsaloons von Apartado. In der Stadt regnet es heute Abend in Strömen. Die Männer zieht es in die Bar, die Frauen in die Messe, die in der kleinen überfüllten Kirche stattfindet. Die Gläubigen stehen dicht an dicht draußen auf dem Bürgersteig unter Regenschirmen und lauschen der Predigt, die auf die Straße übertragen wird. Die metallische Stimme des Geistlichen aus dem Lautsprecher bahnt sich ihren Weg durch die gläubige Menschenmenge und dringt bis in die Bar, wo sie sich mit den Melodien des alten Chansonsängers Oscar Agulelo mischt. An drei Billard-Tischen stümpern ein paar betrunkene Arbeiter herum; immer wieder schwankt einer von ihnen zu dem Urinal, das an der Wand hängt, und erleichtert sich vor aller Augen. Die hübsche Kellnerin windet sich durch die Bar zu Restrepo, läßt sich gleichmütig betatschen, als gehöre das zum Service, und stellt ein neues Glas mit Schnaps vor ihn. „In einem Krieg der Ideologien müssen Menschen sterben“, sagt Restrepo und zeigt mit überraschender Nüchternheit die Grenzen von Uribes Möglichkeiten auf. „Der Staat schafft das nicht. Dazu ist er nicht leistungsfähig genug.“
In dem Raum, den der Staat nicht absichert, sind Parallelgesellschaften herangewachsen. In diesen rechtsfreien Zonen kann keine Regierung mehr Rechte oder Ordnung gewähren, es gibt kaum eine offizielle Polizei, keine neutrale Autorität. Es ist ein wandelbarer, staatenloser Staat, dessen Machtgefüge sich mit den Siegen der Paramilitärs verschiebt, eine Zone des Ausnahmezustands, ein Zustand, der durch das Versprechen der Normalität aufrechterhalten wird: illegal, illusionär, aber befriedet – vorläufig.
Gegen diese Art der Gesetzlosigkeit regt sich kein Widerstand, kein Protest gegen die illegalen Landnahmen der Paramilitärs, kein Ruf nach dem Staat – vielleicht weil alle wissen, daß die Paramilitärs der illegale Arm des Staates sind; ihre Herrschaft mag gegen das Gesetz sein, aber die Regierung in Bogotá gestattet sie.
Vielleicht weil dem Staat ohnehin niemand mehr vertraut und die Rechtlosigkeit unter der illegalen Herrschaft sich in nichts unterscheidet von der unter der offiziellen Obrigkeit.
Wir, in unseren westlichen Gesellschaften, sprechen oft von der „negativen Freiheit“ als einem demokratischen Gut. Wir meinen damit die Abwesenheit staatlicher Intervention in unsere privaten Bereiche – was für ein luxuriöser Begriff von Freiheit das ist, wird in Ländern wie Kolumbien erst deutlich.
In einer allumfassenden sozialen Unsicherheit, ohne jede institutionelle Stabilität, beständig bedroht durch wechselnde, wandernde Fronten des Krieges, unterlaufen von korrupten, bestechlichen Autoritäten, die keine Autorität ausüben, bloß Gewalt – in einer desintegrierten Gesellschaft, in der lediglich die Oligarchie einen festen Ort halten kann, ruft niemand nach „negativer Freiheit“.
Für die ewig Vertriebenen, für die Opfer zwischen den ideologischen Fronten, für all diejenigen, für die sich die Schlachten nicht lohnen, ist die Gewalt ohne jede politische Bedeutung, sind die Kriegsgegner nur mehr Komplizen in der perversen Logik des begründeten Mordens.
Mindestens zwei Generationen haben in ihrem Leben nie etwas anderes als den Krieg kennen gelernt. Sie sind mit der Gewalt aufgewachsen, zu ihrer Sozialisation gehören Tod und Zerstörung, sie haben die Gesetze der Gesetzlosigkeit erlernt.
Leiden und Verluste haben sie ihrer Hoffnungen beraubt. Es heißt, Menschen seien durch Schmerz „verbittert“. Aber diese Redeweise stimmt nicht. Ihre abklingende Wut, ihre immer schwächer werdende Fähigkeit, sich zu empören und sich gegen Mißhandlungen zu wehren – das entspringt nicht einem Gefühl der Verbitterung, sondern der Taubheit. Der Terror des endlosen Krieges hat keine stechende Wut hinterlassen, sondern eine träge, schwere Taubheit, die alle anderen Erfahrungen jenseits der Gewalt überdeckt.
In den Jahren meiner Reisen habe ich meinen Wortschatz für die Beschreibung unterschiedlicher Verletzungen erweitert.
Es ist nicht leicht, die Zeichen der seelischen Deformationen zu entziffern, die der Krieg zurückgelassen hat. Es ist manchmal schwer, dem Schweigen und Stottern der traumatisierten Opfer etwas zu entnehmen, Glauben denen zu schenken, die nicht mehr glaubwürdig klingen, weil ihre Erfahrungen an die Grenzen des Vorstellbaren stoßen.
Ein endloser Lernprozeß.
(...)