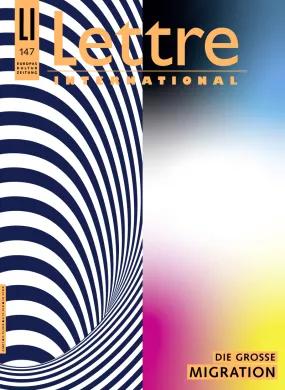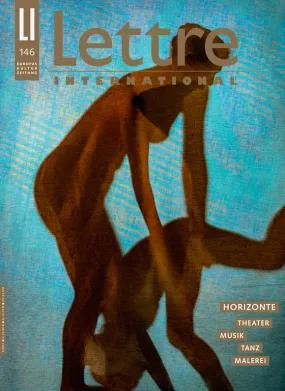LI 70, Herbst 2005
Söldnerherz
Unterwegs mit einem Killer - Reise in die Afrikanischen KriegeElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Englischen von Eva Kemper
Textauszug
Während der nächsten zwei Tage rollten wir durch Simbabwes karge Landschaft, einsam fraßen unsere Reifen die nahezu verlassene Straße, die von Harare aus nordöstlich Richtung Mosambik führt. Politische Gewalt, eine lokale Dürre und Treibstoffknappheit hatten die Einwohner dieser Gegend zu mutlos wirkenden Menschenmengen zusammengetrieben, die sich nahe der Ausgabestellen von Nahrungsmittelhilfen und im Schatten der Kneipenveranden versammelten.
Die Namen der Städte, durch die wir jagten, klangen wie Wörter in einem Lied: Mutoko, Murewa und Nyamapanda. Das Land war von beinahe atemberaubender Schönheit oder voll grausamer Armut; ein Land voll kreischender Geister oder strahlender Möglichkeiten; ein Land voll einladender Wärme oder hoffnungsloser Dürre. Wie man ein Land sieht, hängt davon ab, ob man hindurchfährt oder dort lebt.
Wie man ein Land sieht, hängt davon ab, ob man es verlassen kann oder nicht, wenn es nötig wird.
Die Fenster des Pick-ups waren heruntergekurbelt, weil wir, wie alle in diesem Teil der Welt, mit jedem Tropfen Treibstoff geizten. Und unter diesen Umständen war eine Klimaanlage (ebenso wie die Austreibung von Kriegserinnerungen und das Schreiben über sie) ein unentschuldbarer Luxus. K. war still geworden, und seine Kiefermuskeln hatten zu beben begonnen. Eine Klimaanlage überzieht in ihrer Sanftheit Erinnerungen mit einer feinen Glasur, aber bei den heruntergekurbelten Fenstern strömte die Vergangenheit auf K. ein. „Riechen Sie das?“ fragte er mich mehr als einmal und sah mich an, als erwartete er, den gleichen Ausdruck des Kriegstraumas auf meinem Gesicht zu sehen, den sein eigenes trug. Ich nickte. Doch ich roch nicht das gleiche wie K. Ich roch die Gegenwart, er roch Erinnerungen.
Jeder Ort hat seinen eigenen, besonderen Geruch, und hier in Murewa war es der von heißen, sonnenbeschienenen Steinen (wir befanden uns in einem Tal, das sich zwischen ausgedehnten Kopjes erstreckte, die wie dreißig Meter hohe Furunkel aussahen); es war der stechende Geruch von Ziegen (bereits in den Siebzigern, als K. noch Soldat und auf dem Weg nach Mosambik war, war dieses landwirtschaftlich unbedeutende Land den Afrikanern und ihren kleinen Herden aus Ziegen, Eseln und ein paar Rindern überlassen worden); es war der Geruch von Afrikanern, also Erde auf Haut, Sonne auf Haut, Holzrauch und der metallische Geruch nach frischem Schweiß; es war der Geruch von selbstgebrautem Bier und verbrannten Hühnerfedern und aufgewirbeltem Staub.
Dieser Geruch hat nichts Romantisches an sich. Er ist nicht der Geruch von freien Menschen, die nach ihren Wünschen leben. Eher ist er der Geruch von Menschen, die sich abrackern, plagen und schuften für jedes bißchen Stärkung für ihre Körper, das sie der Erde abringen können. Er ist der Geruch von Menschen, die ausgegrenzt, entmachtet und vergessen wurden. Von Menschen, die keine Stimme besitzen in einer Welt, in der nur die Lautstarken versorgt werden. Der Geruch von Menschen, die nur noch leben, weil sie gerissen, raffiniert und unendlich erfinderisch sind. Theoretisch sind sie „Bauern“. Praktisch sind sie ungeheuer versiert in der Kunst des Überlebens.
Mein Vater sagte einmal zu mir: „Wenn die Welt zum Teufel geht und wir alle bei null anfangen, setz’ ich mein Geld darauf, daß diese Kerle überleben. So ein verfluchter Wall-Street-Fundi würde es da draußen gerade mal einen halben Tag schaffen, bevor er sich den Zeh anstößt und umkippt.“
Die Maispflanzen auf den ausgelaugten Feldern neben der Straße waren wegen des fehlenden Regens verkümmert und brachten nur noch mickrige, dünne Maiskolben hervor. Die Rinder wühlten in fast ausgetrockneten Wasserlöchern den Schlamm auf. Wenn es so am Ende der Regenzeit aussah, mochte ich mir gar nicht vorstellen, wie es im Oktober sein würde.
„Sie wissen, wie Angst riecht“, sagte K. plötzlich. „Ist unverkennbar, oder? Und die Angst von munts riecht anders als die von honkys. Wenn die sich vor Angst einscheißen, dann riecht’s nach Zwiebeln, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Ein honky, der Angst hat, riecht nach süßlichem Käse. Aber das kommt alles aus der gleichen Ecke. Angst ist immer … Angst – das ist der Geruch von freigesetztem Adrenalin.“ Dann riß K. das Lenkrad so herum, daß wir für einige atemberaubende Augenblicke von einer Straßenseite zur anderen schleuderten. Er lachte und sagte: „Kennen Sie so einen Schwung Adrenalin? Hm? War das ’ne Ladung?“
„Ja“, antwortete ich nachdrücklich und nicht gerade versessen darauf, das Experiment zu wiederholen.
„So fühlt es sich an, wenn der erste Schuß fällt“, sagte K.
„Aha.“
„Du denkst, Scheiße, das ist es, und alles wird so unglaublich langsam, daß du meinst, du brauchst eine halbe Stunde, um über beide Schultern zu schauen und sicherzugehen, daß die Männer bei dir sind, und du willst sehen, ob sie ihren Adrenalinkick schon hatten, und versuchst, es so abzustimmen, daß alle gleichzeitig diesen Rausch haben. Dann schreist du: ‘Los!’, genau dann, wenn dieser Kick da ist. Das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem miesen Anführer. Man muß wissen, wann alle bereit sind loszulegen …“
Zwei Kinder standen am Straßenrand und johlten uns hinterher: „Wa-wa-wa!“ Ihre schrillen Stimmen wurden wie Kieselsteine in der heißen Luft hochgewirbelt und stürzten auf uns ein.
K. fuhr fort: „Wenn du zu lange wartest, ist der Rausch vorbei. Dann hast du nur noch einen Haufen Männer mit vollgeschissenen Hosen, aber wenn du den richtigen Zeitpunkt erwischt …“ K. wippte hinter dem Lenkrad vor und zurück, seine Augen glänzten. „Dann rennt ihr alle zusammen aus der Deckung, ‘Aaahhh!’, und dann dieser Rausch … Du fühlst absolut gar nichts, du … einfach ‘Aaahhh!’ Wissen Sie? Dieses Geräusch kommt aus deiner Kehle, und du denkst an nichts anderes als ans Töten. Und ich meine nicht, daß du töten willst, aber es ist das Gegenteil davon, getötet zu werden, also rennst du direkt auf die gooks zu und versuchst, dein Ziel im Auge zu behalten, und das Gewehr ist wie eine Verlängerung von dir und … Deshalb bin ich auf diesem Ohr taub“, K. zupfte an seinem linken Ohrläppchen, „weil du durch den Busch läufst und schießt, und von dem Typ links neben dir, da gehen die Schüsse direkt neben deinem Ohr los, und du versuchst nur, alles genug runterzubremsen, um ordentlich zu schießen. Und wissen Sie, was uns gerettet hat?“
„Nein“, sagte ich.
„Munts können nicht geradeaus schießen. Das hat uns gerettet. Sie hatten ’ne miese Ausbildung und wurden ans Ende der Welt geschickt mit halb so viel Nahrung und Ausrüstung, wie wir sie hatten, und ihre Waffen waren katastrophal. Allerdings kommt ein Munt mit dem gleichen doppelt so lange aus, wie wir es könnten. Wir würden da draußen vielleicht … sagen wir: drei Tage ohne Wasser schaffen. Munts würden fünf Tage schaffen. Und Munts können laufen – ich hab’ einbeinige munts gesehen, die haben sich zehn, zwölf, achtzehn Kilometer aus dem Busch geschleppt. Sehen Sie sich die Typen an“, sagte K. und deutete auf das unwirtliche Land, das sich bis zu den großen, öden, malerischen Felsenhügeln erstreckte. „Im Busch waren sie im Vorteil, weil es nichts härteres gibt als einen Munt. Gibt’s einfach nicht. Aber wenn es zu Feindkontakt kam, haben wir sie in Grund und Boden geschossen. Sie hatten nicht die geringste Chance. Wir waren besser ausgebildet und besser ausgerüstet.“
K. tat so, als hielte er eine Waffe aus dem Fenster und zielte auf einen Teenager, der unter einem Mangobaum döste. „Klick. Schuß. Einmal waka, schon ein toter gook.“
Ich atmete tief ein. „Wie viele Menschen haben Sie getötet?“ fragte ich.
K. schwieg eine lange Zeit. Dann sagte er: „Als ich aus der Armee entlassen wurde, haben sie uns zur Therapie geschickt. Eine halbe Stunde beim Seelenklempner. Das macht … sechs Minuten für jedes Jahr, das ich im Busch war. Drei Minuten für jeden Menschen, dem ich in die Augen sah, bevor ich den Abzug drückte.
Der Typ fragte mich: ‘Haben Sie ein schlechtes Gewissen wegen all der Menschen, die Sie getötet haben?“
Ich sagte: ‘Ich hab nur meinen Job gemacht. Nein, Sir, ich hab’ kein schlechtes Gewissen.’
Dann hat er gefragt: ‘Wie viele Menschen haben Sie getötet?’
Und ich hab’ geantwortet: ‘So viele, wie ich konnte.’
Er meinte: ‘Offensichtlich unterdrücken Sie Ihre Gefühle.’
Ich hab’ ihm gesagt: ‘Sie können mich, Sir!’
Und er: ‘Sie haben eine Menge Leute umgebracht. Sie haben Zivilisten getötet.’
Ich hab’ gesagt: ‘Sir, es war Krieg, die Leute sind mir in die Quere gekommen.’“
K. starrte aus dem Fenster. Draußen huschte ein verfallendes Wandgemälde afrikanischen Landlebens vorbei.
(...)