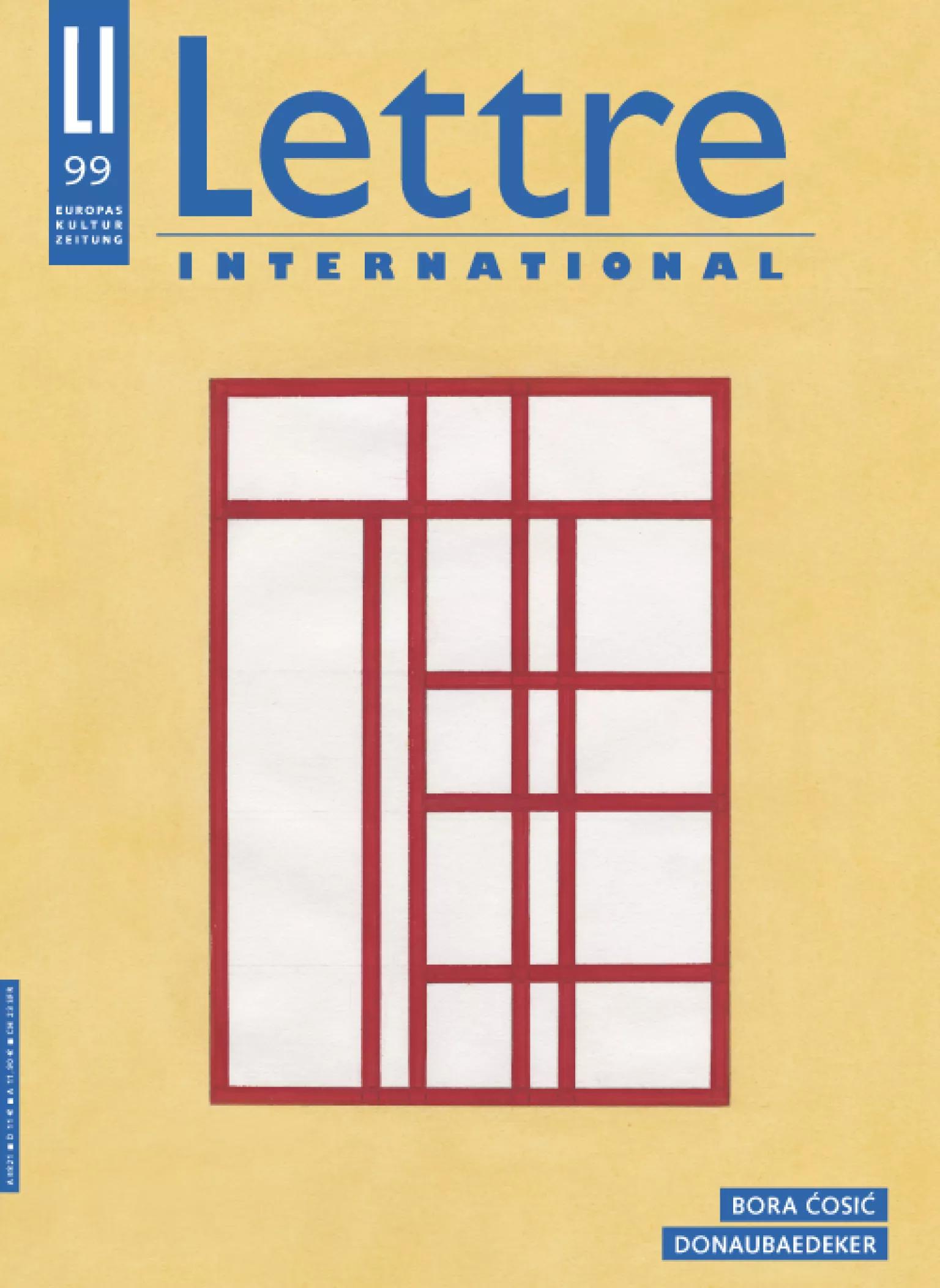LI 99, Winter 2012
Chlebnikows Vögel
Poesie, Natur und Magie fand der russische Dichter am Kaspischen MeerElementardaten
Genre: Essay, Reisebericht
Übersetzung: Aus dem Russischen von Eveline Passet
Textauszug: 9.642 von 52.674 Zeichen
Textauszug
Es gibt Schriften und Menschen, die nur mit einem Blick auf die von der Zeit hauchdünn gezwirbelten Fäden in ihrem Kontext zu verstehen sind. Wobei dieser Kontext unendlich erweiterbar ist. Wie weit, hängt allein vom Interpreten ab, von seinem Bedürfnis und seiner Fähigkeit, mit bestimmten indirekten Zeugnissen zu arbeiten, die mitunter nur Körnchen an wertvollem Wissen über seinen Untersuchungsgegenstand enthalten.
Mir wurde zufällig eine Insel zum Kontext. Ein kleines Naturschutzgebiet. Umschlossen von trägem, trübem Gewässer. Bewachsen längs der Uferlinie mit Weiden, wilden Rosen und Tamarisken, im Innern mit Schilf, Gras, so hart wie eine Hand, Wermut, Hanf und Winden. Der Herbst neigte sich dem Ende zu. Tagsüber schwirrten, sich der letzten Sonne erfreuend, Wespen im hohlen Innern uralter, von der Zeit niedergebrochener Weiden. Nachts, in der „Stunde des Weidengeflüsters“, glichen das Rascheln des Schilfs und das hallende Geplätscher der Welse im schwarzen Wasser dem Rauschen und Pulsieren des Kosmos.
Nacht, erfüllt von Sternen,
Buch, was strahlst an Schicksal,
Nachricht du uns zu?
Freiheit oder Joch?
Von welcher Fügung kündest du
Am mittnachtweiten Firmament?
Der Text – Chlebnikows Gedicht – schlüpfte von allein aus dem Kontext, was nur logisch schien: die Insel gehörte zu jenem Gebiet, wo Wolga und Kaspisee aufeinandertreffen, dem auch Chlebnikow „zugehörte“, der seinem menschlichen Willen nach mal der Newa, mal dem Dnepr, mal der Goryn zustrebte, doch der Wille des Schicksals ließ ihn von Geburt an und bis zum Tod immer wieder mit der mächtigen Wolgaströmung ins Gefäß des Kaspischen Meeres münden. Das ihn verzauberte. Denn wie durch einen zeitweise von brodelndem Nebel verhüllten Zauberkessel sieht Chlebnikow, der die Schleier beiseite bläst, in ihm hindurch auf die Welt: von den eisigen sibirischen Tundren, wo im geräumigen Schädel des Mammuts die Lerche brütet, bis zu den kalmückischen Steppen mit ihren nomadischen Bewohnern, die den schwarzen boso trinken; von den wurzelüberwucherten verlassenen Tempeln in den indischen Dschungeln bis zu den flammendroten Blüten der Gärten Persiens und den hitzeglühenden, die Aromen der üppigen Vegetation des Nildeltas zurückdämmenden ägyptischen Sandwüsten. Der Kessel des Kaspischen Meeres ist eine Linse, in der sich, wie Strahlen oder wie die Flugrouten der Nord und Süd verbindenden Vogelzüge, die Kraftlinien vieler Kulturen bündeln. Von denen jede, sei sie vergessen, unter Wüstensand begraben wie die Hauptstädte des Reichs der Chasaren oder der Goldenen Horde, Itil und Sarai, oder überhaupt nie materialisiert gewesen und nur in der Überlieferung bewahrt wie Stenka Rasins Räubersiedlung, auf ihre Verkörperung im Wort wartet, auf das Genie, das all diese übereinandergelagerten mannigfaltigen historischen Umstände, Naturformationen, lebenden und toten Sprachen, Überlieferungen und Symbole ins Wort zu kleiden, ihnen Stimme zu geben vermag.
„Ich war ein verborgener Schatz und wollte erkannt werden; so schuf ich die Welt“, sagt der Gott der Sufis. Was wohl auch beinhaltet, daß die Gotteserkenntnis zum unendlichen Aufschließen der in der Welt eingeschlossenen Sinngehalte wird, zum Heben der Schätze, die für jeden, der Sucherhartnäckigkeit genug besitzt, bereitliegen. Wer sich nicht bewußt in dem Koordinatensystem verortet, zu dem Chlebnikow gehörte, der wird sich nie eine Vorstellung davon machen können, welche Schätze dem Dichter beschieden waren. Deshalb wird zum unabdingbaren Kontext für sein Verständnis jener Raum, der alles enthält, woraus seine Verse und Prosastücke, seine „Zeitgesetze“ und Neologismen modelliert sind – modelliert, nicht erfunden. Denn Chlebnikows Wortschöpfungen sind, so artifiziell und so sehr sie auch als reine Kopfgeburt erscheinen mögen, keine Erfindung, sondern nur die Projektion dynamischer Eigenschaften des Raumes auf die Sprache. Es gibt auf der Welt kein anderes Natursystem, das so veränderlich wäre, wie es die Deltas der großen Flüsse sind. Das Wolgadelta – uralter Transitraum von Waren aus allen vier Himmelsrichtungen und bekannter „Korridor“ zwischen Ural und Kaspischem Meer, durch den bis ins 15. Jahrhundert immer wieder neue Wellen von Nomaden aus dem Inneren Asiens nach Europa strömten – ist darüber hinaus einer der am stärksten durchspülten Geschichtsorte, eine Kreidetafel der Geschichte, von der jede nachfolgende Woge den skizzenhaften Zivilisationsentwurf der Vorgängerwoge säuberlich heruntergewaschen hat. Das Delta als unermüdlicher Schöpfungsversuch – dies ist der Kontext, der Chlebnikow hervorbrachte.
(…)
Das Genie der Sprache, es mußte unbedingt hier hervortreten, in der russischen Hauptstadt des tatarischen Khanats, am Schnittpunkt der Nomaden- und Karawanenwege, an diesem Ort einer phantastischen Geologie (Ammoniten: der Grund eines urzeitlichen Meeres, Kalksteinschichten, die organischen Stoffe und der Löß des Deltas, Sand, Schlamm, Lydit, Kristallsalz) und einer ebenso phantastischen Pflanzen- wie Vogelwelt, auf der Grenze von Erde/Wasser/Himmel, Fluß und Meer, Staraja Wolga und Kamysjak, Tschornyje Semli und Peski Sulgaschi, von Europa und Asien, russischer Orthodoxie (die ein Mitbringsel des zaristischen Heeres ist), kalmückischem Buddhismus und kasachischem Islam (einem Islam der Steppe, untermischt mit Kamelmilch, Buttertee, bliniumwickelten Hammelinnereien, pudschwerem Grillkarpfen).
In keiner Metropole wäre aus Sprachalchemie anderes hervorgegangen als eine transmentale, transrationale Sprache: Saum (und ist es nicht). Hier aber ist die Alchemie eine der Umgebung inhärente Eigenschaft, es hat keine Kristallisation gegeben und kann sie nicht geben, der Wind weht aus Persien, China, Indien, Europa, das Meer rollt heran und fort, die Wellen der Nomaden ziehen vogelzuggleich vorüber, die Wasserpflanzen quellen im grünen Kessel des Deltas empor und sterben ab – ein unausgesetztes Pulsieren, eine unaufhörliche Schöpfung …
Die Anziehungskraft Persiens belegen sowohl Chlebnikows Teilnahme am Teheranfeldzug als auch unzählige inhaltliche und bildliche Übereinstimmungen zwischen ihm und den altpersischen Dichtern. Ein solches Hingezogensein zum Anderen haben viele große Künstler erlebt, und Chlebnikows „Ineinsfallen“ mit den persischen Mystikern wäre nicht weiter verwunderlich, wenn er orientalischer Sprachen mächtig gewesen wäre und die persische Lyrik hätte im Original lesen können. Aber es ist erwiesen, daß er keine orientalische Sprache beherrschte; indes waren damals auf Russisch nur ganz wenige Texte der klassischen iranischen Dichtung übersetzt, ja es waren überhaupt nur wenige Dichter bekannt.
Wir wissen, daß er mit den Werken Nezamis (1141 bis 1209) vertraut war und bei der Entwicklung des Sujets von Kinder der Otter auf die französische Übersetzung von dessen Alexanderbuch zurückgriff. Ein komplexes System kultureller Spiegelungen trug ihm auch ein anderes Epos des persischen Dichters zu, Leila und Madschnun, in dem die Figur des aus Liebe dem Wahnsinn verfallenden, in der Einöde umherirrenden und dabei Verse auf die Geliebte stammelnden Dichters fulminant gestaltet wird.
Doch so spärlich die Texte der Sufi-Dichtung sind, die Chlebnikow zugänglich waren, so ist er vom Orient doch derart stark magnetisiert, als habe er all das gelesen, was erst Jahrzehnte nach seinem Tod ins Russische übersetzt wurde (so kamen Nezamis Werke erst zwischen 1940 und 1959 heraus), ja sogar das, was bis heute nicht bei uns erschienen ist, darunter solche für unseren Kontext bedeutenden Werke wie Attars Vogelgespräche und Ghazalis Vogelsendschreiben. Mehr noch, man könnte meinen, er habe Ausgaben gelesen, die umfängliche Kommentare zu den mystischen Dichtern bieten wie zu den metaphorischen Kodizes, ohne deren Kenntnis die „Vielgeschichtetheit“ dieser Poesie nicht zu verstehen ist. Aber Chlebnikow standen all diese Sekundärquellen nicht zur Verfügung. Nicht René Guénons und ebensowenig Annemarie Schimmels Publikationen zur islamischen Mystik, die nicht nur nicht ins Russische übersetzt, sondern nicht einmal geschrieben waren, ja ihre Verfasser hatten ihre Forschungen noch nicht begonnen. Und doch schreibt Chlebnikow mitunter so, als befinde er sich in der Tradition, als habe er von Attar selbst ein geheimes poetisches Vermächtnis erhalten und bedürfe keiner kulturwissenschaftlichen Rekonstruktionen … Darüber hinaus widersetzt sich Chlebnikow bewußt einer Verengung des Blicks auf die Welt im Sinne einer ausschließlichen „Russischkeit“ – „Das Hirn des Landes kann nicht nur großrussisch sein“ – und fordert ein „kontinentales“ Bewußtsein, dessen Anbindung an die kulturellen und mythologischen Traditionen anderer Völker. Bedenkt man noch, daß Astrachan zu Beginn des letzten Jahrhunderts auch ohne diese Forderungen ein echter ethnischer und sprachlicher Schmelztiegel war, in dem, gleichberechtigt mit den russischen Wörtern, unglaubliche Wortgemixe und zahlreiche Wörter aus den orientalischen Sprachen brodelten (so verwendete man zu Chlebnikows Zeit für die Matrosen auf den Kauffahrern im Kaspischen Meer noch das persische musur, für die heftigen Sturmwinde das tatarische schurgan, und auch für eine Reihe von Vogelnamen gab es Dubletten), so klingt die Feststellung nicht befremdlich, daß jene literaturwissenschaftliche Goldader namens „die russischen Dichter und der Orient“ unmöglich ausgebeutet werden kann, ohne den Batzen Chlebnikow zu fördern. Er versucht gleichsam, den ganzen Reichtum des ihn umgebenden sprachlichen Kontextes für die Dichtung nutzbar, ihn zum Literaturgut zu machen. Durch Chlebnikow hindurch sprechen die schriftsprachlosen Nomaden wie die Opferpriester der vom Sand verwehten Städte.