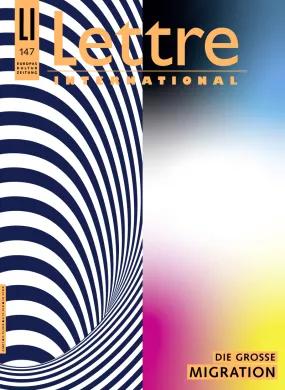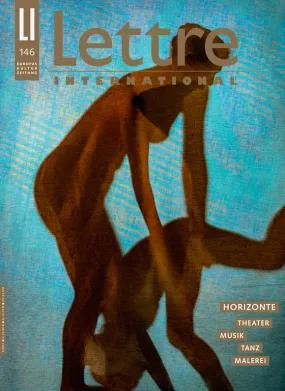LI 38, Herbst 1997
Kontinentalverschiebung
Nach dem kongolesischen Krieg - Zentralafrika im UmbruchElementardaten
Genre: Bericht / Report, Reportage
Übersetzung: Aus dem Englischen von Bernd Samland
Textauszug
(...) Das Ausmaß, in welchem die kongolesische Revolution die Welt überrascht hat, enthüllt eine hartnäckige falsche Auffassung, welche die westlichen Einstellungen gegenüber dem Afrika nach Ende des Kalten Krieges dominiert hat: Afrikaner erzeugen humanitäre Katastrophen, machen aber wirklich keine sinnvolle Politik. Ruanda war der eindeutigste Fall von Genozid seit Hitlers Krieg gegen die Juden gewesen, und der Westen schickte in die von Mördern kontrollierten Lager Decken, Dosen mit Bohnen und medizinische Versorgung, offenbar in der Hoffnung, daß sich alle zukünftig ordentlich verhalten würden.
Als das winzige Ruanda im letzten Oktober gegen das riesige Zaire losschlug, lauteten die Zeitungsberichte im Grunde: Hier ist mal wieder die Hölle los, schon wieder bringen sie sich gegenseitig um. Die örtlichen Tutsi erhoben sich, Mobutus Armee flüchtete völlig chaotisch, die humanitären Helfer wurden evakuiert, die Lager aufgelöst und die Insassen zerstreuten sich, und gegen Ende des Monats entdeckten einige Reporter dann einen Sprecher der Rebellen, der sagte, sein Name sei Laurent Kabila. Er war kein Tutsi, und er hatte auch keine bekannten Beziehungen zu Ruanda. Seiner Herkunft nach stammte er aus dem Volke der Luba in der Provinz Shaba, und er beanspruchte das anachronistische Privileg, sich einfach als Kongolese zu erkennen zu geben. Anfang November hatte sich Kabila inzwischen in den Chef der Rebellen verwandelt, der sagte, er werde Kinshasa einnehmen, was weithin als eine Art Witz aufgefaßt wurde.
Kabila jedoch läßt nicht auf ein besonders fröhliches Gemüt schließen. Körperlich eher schwerfällig, mit einem sehr tiefen Schwerpunkt, blinzelt er beunruhigend langsam. Ich habe das bei mehreren Pressekonferenzen beobachten können. Einen Augenblick sieht er aus, als würde er mitten im Satz stehend einschlafen, so daß man, wenn seine Augenlider wieder hochgehen, mit Überraschung und ziemlicher Erleichterung sieht, daß er die ganze Zeit dagewesen ist. So geht es auch mit dem Eindruck, den Kabila über seine politische Führungsstärke zu erwecken sucht - daß er die ganze Zeit dagewesen ist, um standhaft die Ermordung von Patrice Lumumba zu rächen, des einzigen vom Volke gewählten nationalen Führers in der Geschichte des Kongo.
Lumumba, der in der Rhetorik der Allianz eine Art politischer Wiederkunft erfahren hat, ist eine jener kanonischen politischen Gestalten, deren Format anscheinend darauf beruht, daß sie ermordet wurden, bevor sie noch die Möglichkeit hatten, überhaupt etwas zu erreichen. Kurz nachdem die belgischen Kolonialflaggen eingeholt waren, fanden im Kongo 1960 Wahlen statt; Lumumbas Kongolesische Nationalbewegung war die einzige große Partei, die nicht nach Stammeszugehörigkeiten definiert war, und so wurde er Premierminister. Wenige Jahre zuvor noch war er ein barfüßiger Postbeamter gewesen, und knapp acht Monate nach seinem Amtsantritt war er tot. Er war jung und unsicher, und er hatte einige anscheinend impulsive strategische Stümpereien begangen, vor allem, da er Moskau um Hilfe bat, als Mobutu mit Washingtons Unterstützung einen Putsch inszenierte. Der US-Botschafter im Kongo nannte ihn Lumumbawitsch, die C.I.A. schickte Giftmörder los, und Mobutu sackte die Trophäe ein.
Daß Lumumba eine Ahnung hatte, worum es im Kalten Krieg, der ihn das Leben kostete, überhaupt ging, scheint eher zweifelhaft. Die Demütigungen durch den Kolonialismus hatten ihn gelehrt, woran Afrika krankte: Die Afrikaner waren politisch nicht darauf vorbereitet, ihre neuen Nationen zu regieren; und während er noch nach Heilmitteln suchte, wurde er von Mobutu geschluckt, der das Übel auch erkannt und den - richtigen - Schluß gezogen hatte, daß der Westen ihm alles geben würde, damit es auch so bleibe. Nach Lumumbas Tod ist sein Name zum Synonym für die gestohlene Unabhängigkeitsbewegung geworden, wie für das Credo, daß die Afrikaner sich über alle Stammes- und Gebietsgrenzen hinaus vereinigen müssen, um ihr Schicksal selbst bestimmen zu können; andernfalls werden sie vernichtet.
Kabila war einundzwanzig, als Lumumba ermordet wurde. Er hatte in Frankreich Philosophie studiert, für eine Lumumba-Partei gearbeitet, und keinen Beruf. Anfang der sechziger Jahre flammten im Ostkongo immer wieder Rebellionen gegen Mobutu auf, und Kabila hat sich in viele davon eingereiht, ehe es Mobutu mit der Hilfe amerikanischer und belgischer Streitkräfte und einem Babel weißer Söldner 1965 gelang, die Herrschaft über das Land zu konsolidieren. Kabila schlug sich daraufhin in die Berge von Süd-Kivu, wo er die Revolutionäre Volkspartei gründete; den Rest der sechziger und die gesamten siebziger Jahre lebte er als isolierter Rebellen-Kriegsherr. Er stand an der Spitze einer Quasi-Kommune, eines kleinen proto-maoistischen Reiches von eigenen Gnaden und dealte mit Gold. Während Mobutu weiterhin seine übrigen Widersacher entweder aus der Welt schaffte oder auf seine Seite zog, blieb Kabila der Ruhm, freigeblieben zu sein, und Anfang der achtziger Jahre hatte es den Anschein, daß er davon genug hatte. Er ging nach Tansania, betrieb unter mehreren falschen Namen verschiedene Geschäfte und verschwand aus der Öffentlichkeit bis zum Ende des letzten Jahres, als er begann, die alte Flagge der Lumumbistera über den "befreiten Gebieten" im Osten zu hissen.
Während kongolesische Rekruten zu Tausenden zu seinen Fahnen eilten, war es wohl der Auftrieb, der von Ruandas Kagame und Ugandas Musevini und der Aura der pan-afrikanischen Allianz hinter der Allianz ausging, der den aufständischen Kabila aus der relativen Namenlosigkeit seiner früheren politischen Rollen heraushob. Die verschiedenen Regime, die sich hinter Kabilas Kampf zusammenfanden, stellten einen Generationswechsel im politischen Leben Afrikas dar. Als die europäischen Imperien sich Anfang der sechziger Jahre aus den meisten Teilen des Kontinents zurückzogen, waren erst wenige neue afrikanische Politiker älter als dreißig gewesen, und manche waren noch Kinder. Sie waren in einem vorgeblich selbstregierten Afrika erwachsen geworden; doch während sie erwachsen wurden, sahen sie ihre politischen Führer - selbsternannte Gottheiten wie Idi Amin und Mobutu - als unreife Menschen, deren man sich schämen mußte, anstatt auf sie stolz sein zu können, und die Worte wie "frei" und "unabhängig" nicht verdient hatten.
Die Korruption, die weite Teile Afrikas heimsuchte, war nicht nur eine Sache der Bestechung; die Seele stand auf dem Spiel. Und die heranwachsende Generation erlebte mit Entsetzen, daß selbst, wenn der Westen beteiligt war, die postkolonialen Qualen den afrikanischen Völkern von afrikanischen Politikern auferlegt wurden. Museveni, die graue Eminenz der neuen Führungsschicht in Zentralafrika, hat es mir gegenüber so ausgedrückt: "Daß der Westen Afrika beherrscht, liegt nicht so sehr an den Ausländern - es liegt vielmehr an den einheimischen Kräften, die schwach und unorganisiert waren."
Im französischsprachigen Afrika läßt sich der Begriff "postkolonial" eigentlich nicht anwenden, wenn man die Galerie verworfener Despoten bedenkt, die nur durch die französische Schirmherrschaft im Amt gehalten werden können. Frankreich hat mit Aggressivität ein neokoloniales Imperium im gesamten frankophonen Afrika aufrechterhalten, um sich als Weltmacht aufzuplustern, um sich günstige Märkte zu sichern und die französische Sprache und Kultur zu fördern. Die Pariser Politik hat die frankophonen Gebiete stets weniger als Vasallen denn als Satelliten behandelt, und ihre Satellitenstaaten bildeten einen gehorsamen Block in afrikanischen und internationalen Angelegenheiten. Wenn diese Satelliten in Schwierigkeiten gerieten, hat Frankreich sie oft militärisch rausgehauen. Und die ganzen neunziger Jahre hindurch hat Paris in einem anhaltenden Anfall wildgewordener imperialer Fehlbeurteilung den génocidaires von Ruanda und Mobutu Geld, Waffen und diplomatische Unterstützung zukommen lassen, damit sie als Bollwerke gegen die "anglophone Bedrohung" eines Kagame und Museveni dienen konnten. Nach dem Krieg im Kongo hat mir ein amerikanischer Diplomat gesagt, das "korrupte" und "klägliche" frankophone Afrika "bricht eindeutig zusammen". Mit charakteristischer Galgenlogik hat Kagame mir gegenüber einmal geäußert: "Wenn sie wollten, daß die Leute hier französisch sprechen, hätten sie nicht helfen sollen, die vielen Leute umzubringen, die französisch gesprochen haben."
So sehr ist der Kongo unter Mobutu verwüstet worden, daß während der Rebellion der Allianz amerikanische Zeitungen die Ära der belgischen Kolonialherrschaft häufig eine Art Goldenes Zeitalter genannt haben. (Nur ganz nebenbei wurde erwähnt, daß schätzungsweise zehn Millionen Kongolesen dafür mit dem Leben bezahlt haben, und so gut wie gar nicht wurde erwähnt, daß in den achtzig Jahren, die Brüssels Wohltätigkeit währte, weniger als zwanzig Kongolesen einen Collegeabschluß erworben hatten, während kein einziger Offizier werden durfte.)
Bei seiner Amtseinführung am 27. Mai sprach Kabila einen langen Nachruf auf den Mobutismus und erklärte: "Dies nun ist, ob es Ihnen gefällt oder nicht, die Ära der Dritten Republik, das heißt, die Antithese zur Zweiten Republik." Er verkündete aggressive Wirtschaftsreformen und versprach eine neue Verfassung sowie Wahlen innerhalb von zwei Jahren. Kabilas Rede bekam im radio trottoire gemischte Kritiken. Der Tenor lautete: Klingt gut, warten wir ab, was er tut. Die Einwohner von Kinshasa hatten mehr übrig für Ugandas Museveni, einen von fünf Präsidenten der Nachbarstaaten, die auf Kabilas Podium auftraten und kurze aufmunternde Worte sprachen.
Museveni verkündete, daß Lumumbas offene Rechnung nun beglichen sei, und sagte: "Afrika ist weder anglophon noch frankophon. Mein Name ist Yoweri Museveni, Sohn des Kaguta. Ich bin bantuphon und nicht anglophon, denn von Kamerun bis Südafrika sprechen wir Bantu-Sprachen." Dies war eine Solidaritätserklärung vom gleichen Rang wie Präsident Kennedys "Ich bin ein Berliner", und wie in Kennedys Worten war auch in ihr eine Herausforderung enthalten. Den euro-amerikanischen Architekten der postkolonialen Ordnung rief sie zu: Ihr könnt gerne helfen, aber nach unseren Bedingungen. Den Afrikanern rief sie zu: Setzt das Programm in die Praxis um. Das Programm lautete: Einheit.
Seit den sechziger Jahren schon will Museveni die heutige Landkarte Afrikas, die 1885 von europäischen Kolonialmächten in Berlin festgelegt wurde, korrigieren und an die Stelle der alten Grenzen gemeinsame organischere regionale Märkte und politische Föderationen setzen. Dem stand natürlich Mobutus Zaire immer im Weg, und neben dem offensichtlichen Interesse an militärischer und politischer Stabilität wurde die pan-afrikanische Beteiligung an der kongolesischen Revolution weitgehend von wirtschaftlichen Motiven getrieben. "Amerika kann ohne den Kongo leben. Ruanda nicht", sagte mir ein Berater Kagames. "Für sich allein ist unser Land nicht lebensfähig."
Überall, wo ich in Zentralafrika gewesen bin, war die Rede davon, eine regionale politische und wirtschaftliche Föderation zu bilden, der bis zu sechs der heutigen Länder angehören könnte. Ein politischer Amtsträger der Allianz nannte diesen Traumstaat die Demokratische Republik Lumumba, und Kabila hat voll Begeisterung von den Vereinigten Staaten von Afrika gesprochen. Ruandas Kagame hat mir gesagt, er werde dem nicht im Wege stehen, und als ich Museveni gefragt habe, was er von einer solchen übernationalen Föderation halte, sagte er: "Es könnte nicht nur dazu kommen. Es wird dazu kommen."
(...)
Wie Kabila wird auch Museveni oft als ehemaliger marxistischer Guerillero beschrieben; doch in seiner jetzigen politischen Analyse favorisiert er die Bildung politischer Gruppierungen entlang der Klassengrenzen, die zu einer "horizontalen Polarisierung" führt, im Gegensatz zu der "vertikalen Polarisierung" nach Stammes- oder Gebietszugehörigkeit. "Deshalb sagen wir, fürs erste soll sich die politische Konkurrenz nicht zwischen Gruppen, sondern zwischen Individuen abspielen", sagte er und fügte hinzu: "Denn wir werden wahrscheinlich keine gesunden Gruppen bekommen. Wahrscheinlich werden wir ungesunde Gruppen bekommen. Weshalb also dies Risiko eingehen?"
Musevenis Beschwerde richtet sich gegen das, was sich kosmetische Demokratie nennen ließe, wenn Wahlen, die auf Befehl von "Geber-Regierungen" nur um der Wahlen willen abgehalten werden (man denke an Kambodscha), in politisch geschädigten Gesellschaften schwache oder korrupte Kräfte an der Macht halten. "Wenn ich herzkrank bin und dabei den Eindruck zu erwecken suche, gesund zu sein, muß ich einfach sterben", meinte Museveni zu mir. Wir unterhielten uns darüber, wie der Westen, nachdem er den Kalten Krieg gewonnen und seine simple Schablone zur Unterscheidung der Guten von den Schlechten auf der ganzen Welt verloren hat, eine neue politische Religion darin gefunden hat, Mehrparteien-Wahlen zu fordern (zumindest in wirtschaftlich abhängigen Ländern, in denen nicht viel Chinesisch gesprochen wird). Museveni nannte das eine Politik "nicht nur der Einmischung, sondern der Einmischung aufgrund von Ignoranz und natürlich auch einer gewissen Arroganz". Er sagte: "Diese Leute scheinen zu sagen, daß die entwickelten und die unentwickelten Teile der Welt auf ein und dieselbe Weise regiert werden können. Das ist ihre politische Linie, und die halte ich - höflich ausgedrückt - für reinen Quatsch, denn es ist unmöglich, radikal verschiedene Gesellschaften auf ein und dieselbe Weise zu führen."
Als Kabila seinen Zweijahresplan für Wahlen verkündete, sagte er: "Wir sind nicht in Eile. Ganz und gar nicht. Erst muß Ordnung herrschen." Aber eine Anzahl seiner Minister und Berater fand sehr wohl, daß mit zwei Jahren die Dinge überstürzt würden. Das Thema war heftig diskutiert worden, wie ich hörte, und Kabila hatte ursprünglich nur ein Jahr warten wollen. "Wir haben gesagt, dann bricht das Land zusammen", berichtete mir ein Funktionär der Allianz eines Abends in Kinshasa, als die Erschütterung durch Artillerie die Fensterscheiben zum Klirren brachte und der Nachthimmel von Leuchtspurgeschossen funkelte.
Gekämpft wurde auf dem Flußufer gegenüber, in Brazzaville, im anderen Kongo - in der Republik Kongo, wo die Bevölkerung am 27. Juli zu den Urnen hatte gehen wollen, um einen Präsidenten zu wählen. Statt dessen zettelten die beiden Hauptkandidaten am 5. Juli einen Krieg an, der zweitausend ihrer möglichen Wähler ums Leben gebracht und weite Teile ihrer schönen Stadt in Trümmer gelegt hat. Am selben Tag klotzte eine von einem halben Dutzend unbändig gegen Kabila agitierender Zeitungen, die überall in Kinshasa erhältlich waren, mit der Riesenschlagzeile: Demnächst hier, Bürgerkrieg. Der Artikel wies darauf hin, daß der Bürgerkrieg, ungeachtet Kabilas Präsidentschaft, nicht aufgehört hatte: in weiten Teilen des Landes gingen die Kämpfe weiter, und die alte, gewaltlose Opposition gegen Mobutu, die Kabila von seiner Regierung ausgeschlossen hatte, ging nicht sang- und klanglos in Rente. Deshalb konnte man sich durchaus vorstellen, während Projektile aus Brazzaville die Büsche in der Nähe des Präsidentensitzes am Ufer in Kinshasa rasierten, daß Kabila mit der Verschiebung der Wahlen seinem Lande im Grunde einen Dienst erwies.
Doch im radio trottoire herrschte die Meinung vor, daß Kabila lediglich ein Strohmann des "ruandisch-ugandischen" Imperialismus sei. "Die Leute sagen, jetzt werden wir nicht mehr von Weißen, sondern von Schwarzen kolonisiert", meinte ein Einwohner von Kinshasa zu mir. Museveni, der keine ugandischen Truppen im Kongo eingesetzt haben soll, läßt sich von derlei Meinungen nicht aus der Ruhe bringen. "Weil sie Marionetten der Franzosen waren, glauben sie, daß alle andern auch nach Marionetten suchen oder alle andern womöglich Herren suchen", sagte mir Museveni. Er fand es selbstverständlich, daß andere Länder der Region sich sein Beispiel vor Augen halten sollten. "Als Martin Luther seine Kritik an den Papisten veröffentlichte, hat die sich deshalb so verbreitet, weil sie an verschiedenen Orten auf offene Ohren stieß", sagte er. "Und als die Französische Revolution ausbrach, gab es bereits in verschiedenen europäischen Ländern republikanische Elemente. Als nun in Uganda Veränderungen im Gang kamen, die sich gegen die Diktatur von Idi Amin richteten, ja, da übten diese Ideen eine Anziehung aus."
Daß Museveni sich im Lichte europäischer Geschichte der Neuzeit präsentiert, ist ein Maßstab für seinen entschlossenen Optimismus. Er hat genau studiert, wie die großen Demokratien aus dem politischen Sumpf entstanden sind. Zweifellos hat er sich auch über die Amerikanische Revolution sachkundig gemacht; sie erforderte acht Jahre des Kampfes, vier weitere Jahre bis zur Ratifizierung der Verfassung und dann noch zwei Jahre bis zu den ersten Wahlen - insgesamt dreizehn Jahre, nachdem die Unabhängigkeitserklärung "mit würdiger Achtung vor der Meinung der Menschheit" nicht nur die Gründe für den antikolonialistischen Kampf erklärt, sondern auch die göttliche und universale Rechtmäßigkeit eines solchen bewaffneten Kampfes verkündet hatte. Die Geschichte müßte Museveni eigentlich gefallen. Der General, der die Revolutionsarmee aus dem Busch führte, hat die ersten beiden amerikanischen Wahlen gewonnen.
Museveni ist erst im letzten Jahr zum ersten Mal gewählt worden, zehn Jahre nach seiner Machtergreifung, und im Jahre 2001 kann er sich noch einmal für eine fünfjährige Amtszeit zur Wahl stellen. Aber vor einem glatten Machtwechsel zu einem gewählten Nachfolger wird die "Kein-Parteien-Demokratie" nicht die entscheidende Prüfung ihrer Institutionen bestanden haben. Bis dahin hängt fast alles vom guten Willen und von den Fähigkeiten des Führers ab. Was das für den Kongo bedeutet, bleibt abzuwarten. Museveni, der Kabila seit den siebziger Jahren kennt und ihn mit Kagame bekanntgemacht hat, wollte sich über dieses Thema nicht weiter äußern. Er hat nur gesagt: "Mir war gleich klar, daß er ein entschlußkräftiger Mann war", und während manche im Westen daran denken mochten, Kabila zu destabilisieren, sei er der Meinung, sie könnten "die Lage nicht umdrehen - es sei denn, Kabilas eigene Leute machen selber sehr schwerwiegende Fehler".
Am ersten Juniwochenende ist Bill Richardson, US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, in den Kongo geflogen, um sich in Lubumbashi, einer Stadt im Südosten, mit Kabila zu treffen. Vor ihrer Begegnung gab Außenminister Bizima Karahe einen Empfang. Karahe bedankte sich bei den Vereinigten Staaten für die Hilfe in der "ersten Phase unserer Revolution" und erbat weitere Hilfe in der zweiten Phase, "um die Demokratie aufzubauen, in der die Menschenrechte geachtet werden". Das war zumindest eine geschickte Formulierung, da die US-Hilfe in der ersten Phase weitgehend aus dem bestanden hatte, was mir ein Funktionär der Allianz als "sehr konstruktive Nichtbeteiligung" beschrieben hatte. Ohne eine Politik für Zentralafrika hatte Washington, auf dem falschen Fuß erwischt, während der Rebellion zumeist Wahlen für das immer mehr schrumpfende Gebiet Mobutus gefordert und darum gefleht, daß es zu keiner größeren humanitären Krise kommen möge, die teure Gesten der Betroffenheit erfordern würden, um die heimischen Fernsehbildschirme sauber zu halten.
Dann waren die Schwierigkeiten doch auf den Bildschirm gekommen. Seit Mitte März hatten die westlichen Helfer, Diplomaten, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten im östlichen und nördlichen Kongo berichtet, daß ruandische Hutus nach und nach in Massakern von Truppen ermordet wurden, die mit der Allianz und den kongolesischen Dorfbewohnern im Verbund standen. Die Vereinten Nationen wollten eine Menschenrechtskommission zur Untersuchung schicken, und Kabila hatte gemauert. Richardsons Botschaft lautete: Entweder laßt ihr die Kommission einreisen, oder ihr werdet international isoliert und könnt die Hilfe abschreiben.
Kabilas Leute waren verständlicherweise empfindlich, was die Massaker anging. Einerseits wiesen sie die Anschuldigungen zurück; andererseits beharrten sie darauf, man müsse alle Morde an Hutus im richtigen Kontext sehen. Im November hatten ruandische Truppen eine Massenrepatriierung der überwältigenden Mehrheit der früheren Lagerbevölkerung aus dem östlichen Zaire erzwungen. Letztlich waren siebenhunderttausend Menschen im Marsch nach Ruanda zurückgebracht worden, wo sie ordentlich reintegriert wurden. Die Verbliebenen waren nach Westen in den Dschungel geflüchtet. Keiner weiß, wie viele es waren, denn in den Lagern hat keine ordentliche Zählung stattgefunden. Aber unter den Verbliebenen waren Zehntausende von Männern aus der völkermordenden Armee und den Milizen, die schließlich den Kern von Mobutus Verteidigungsstreitmacht bildeten. Wie auch in den UN-Lagern umgaben sich die Kämpfer mit Frauen und Kindern, die sie als menschliche Schutzschilde benutzten, und so haben sie auch gelitten. Aber viele dieser Morde waren allem Anschein nach auch reine Willkürakte, und es gibt Berichte über mehrere Massaker, die ganz nach Art von Todesschwadronen begangen worden sind.
Diese Morde wurden die Rache für den Genozid genannt, und die Schuld daran wurde vor allem den Tutsi-Truppen aus dem Kongo und aus Ruanda zugeschrieben. Zur gleichen Zeit wurden Ende April täglich ganze Flugzeugladungen ruandischer Hutu - darunter viele tüchtige junge Männer - von den Vereinten Nationen in Ruandas Hauptstadt zurückgeflogen, wo sie repatriiert und wiedereingegliedert werden sollten. Die komplexe Situation und die Gewohneit der Allianz, Untersuchungskommissionen den Zugang zu verwehren, boten widersprüchlichen Interpretationen weiten Raum. "Als sie gekämpft haben, waren sie Mobutus Armee, und wenn sie sterben, werden sie zu Flüchtlingen", hat mir Karahe gesagt. "Das eben habe ich nie verstanden, und ich wünschte, das könnte mir mal jemand erklären."
Richardson kam guter Dinge von seiner Begegnung mit Kabila zurück. Kabila hatte versprochen, am 20. Juni einen Voraustrupp der UN-Menschenrechtsuntersuchungskommission zu empfangen und am 7. Juli der gesamten Kommission die Arbeit mit ungehindertem Zugang zu gestatten. Richardson hat mir später in seinem Flugzeug gesagt: "Ich kenne Kabila zwar erst sechs Wochen, doch ich sehe in ihm einen Menschen, der wächst, in seine Führungsrolle hineinwächst. Er ist kein Intellektueller. Er ist kein tiefer Denker. Aber er ist klug aus Erfahrung, hat jede Menge politisches Know-how, hat ein gutes Timing, und er ist ein guter militärischer Stratege." Dann hat Richardson noch gesagt: "Er war bei der Verhandlung über ein Datum für die Untersuchung der Gemäßigte", und fügte hinzu: "Ich glaube, er ist gerne Präsident. Er hat ein bißchen was Messianisches." Andere aus Richardsons Begleittroß nannten Kabila eher "eine Übergangsfigur", was gewiß ein sicherer Tip ist. Niemand hätte eine Voraussage gewagt, wer oder was folgen könnte.
Nach seinem Treffen mit Kabila hat Richardson noch am selben Tag ein Lager für ruandische Hutus außerhalb von Kisangani besucht, nicht weit entfernt von der Stelle, wo Berichten zufolge die letzten Massaker sich zugetragen haben. Im Lager befanden sich hauptsächlich Frauen und Kinder, die monatelang durch den Dschungel geirrt waren; sie waren in schlechter Verfassung, manche gerade noch so am Leben - nur Haut und Knochen, die reinsten Skelette. Nach einem gemächlichen Rundgang stellte sich Richardson am Tor des Lagers auf und verlas eine vorbereitete Erklärung: "Mit Genugtuung nehmen wir alle die Tatsache zur Kenntnis, daß in den letzten Wochen mehr als vierzigtausend Flüchtlinge über Kisangani in ihre Heimat zurückgekehrt sind. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, daran zu erinnern, daß die humanitäre Krise im Kongo, die wir alle so gut kennen, nicht erst in den letzten Monaten begonnen hat. Diese Tragödie hat ihren Ursprung 1994 im Völkermord in Ruanda. Das Versäumnis der internationalen Gemeinschaft, nicht nur auf den Völkermord adäquat zu reagieren, sondern auch auf den nachfolgenden Umstand, daß sich die Völkermörder unter die echten Flüchtlinge im Osten von Zaire mischen konnten, hat die Krise noch verlängert. Dieses Klima der Straflosigkeit wurde weiter verschlimmert durch die ethnischen Auseinandersetzungen und Säuberungen in der Region [Nord-Kivu] - und auch durch die Politik des früheren Präsidenten Mobutu, den völkermordenden Truppen zu gestatten, auf seinem Territorium zu operieren, sich zu rekrutieren und mit Nachschub zu versorgen. Tragischerweise ist dieses Kapitel noch nicht beendet. Die Berichte über Morde halten an. Wir alle, die neue Regierung der Demokratischen Republik Kongo, ihre Nachbarn und die internationale Staatengemeinschaft haben die Verantwortung, der Ermordung unschuldiger Zivilisten ein Ende zu setzen. Wir müssen auch die echten Flüchtlinge schützen, die Bemühungen zur Repatriierung fortsetzen und dafür sorgen, die Völkermörder vor den Richter zu bringen."
Dieses Eingeständnis der Realität war bis heute die ranghöchste offizielle Erklärung eines westlichen Politikers. Sie wurde abgegeben im Beisein von Reportern der New York Times, der Washington Post, der Los Angeles Times und mehrerer Nachrichtenagenturen, und nicht einer hat darüber berichtet. Kagame hat mir später gesagt, daß er ein Typoskript der Erklärung gesehen und sich gefragt habe, ob es eine Fälschung wäre. Als ich ihm versicherte, daß Richardson diese Worte tatsächlich gesagt hatte, nannte er sie ein "wichtiges Eingeständnis" und "etwas Großartiges in dieser Situation" und sagte: "Vielleicht sollte jemand sie ins Internet bringen."
Ende Juni traf die UN-Untersuchungsgruppe in Kinshasa ein, pünktlich zwar, doch konnte sie bis jetzt ihre Arbeit noch nicht aufnehmen. Kabila war wütend, als er erfuhr, daß die Gruppe unter der Leitung von Roberto Garreton stand, einem chilenischen Menschenrechtsbeobachter, dessen Objektivität in Kabilas Augen durch frühere Anschuldigungen gegen die Allianz-Truppen kompromittiert war. Nach mehrwöchigem Streit erklärte sich UN-Generalsekretär Kofi Annan bereit, einem anderen die Leitung der Kommission zu übertragen, und Garreton erklärte in einem Bericht, die Ermordungen von Hutus im Kongo "könnten Akte des Genozids darstellen".
(...)