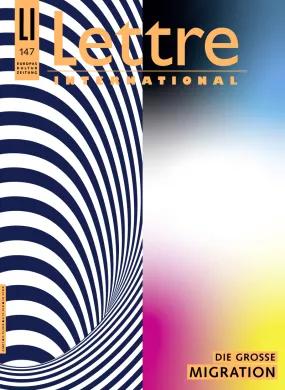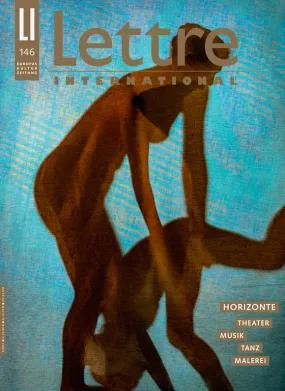LI 65, Sommer 2004
Der Betrachter an sich
Über Theater, Ready-Mades und das transzendentale Subjekt der KunstElementardaten
Textauszug
Carl Hegemann: Du hast einmal gesagt, daß die auf die Bühne des Theaters transportierten digitalen Bilder den Charakter von Ready-mades haben und daß neben dem Museum oder der Galerie, in denen man Ready-mades ausstellen kann, das Theater der einzige Ort ist, an dem dies ebenfalls möglich ist.
Boris Groys: Ich bin mit Frank Castorf völlig einverstanden, daß die Installation, speziell die Videoinstallation, der Roman des 20. oder 21. Jahrhunderts ist. Der Roman war eine absolut gefräßige literarische Form, die alle anderen Formen aufgefressen hat, und zwar, weil – wie Bachtin das sehr gut in seiner Romantheorie erklärt – der Roman im Grunde nur mit Raum und Zeit operiert. In diese raum-zeitlichen oder chronotopischen Verhältnisse, wie Bachtin sagt, kann man im Grunde alles integrieren. Das ist das, was jetzt mit der bildenden Kunst in Form der Installation passiert. Installation ist nichts anderes als Reduzierung aller Kunstmedien auf die allgemeinsten Bedingungen der Raum/Zeit. Ich frage mich dabei nicht mehr, was die Leinwand oder das Papier oder der Film ist, ich habe einfach einen Kunstraum. Das einzige Medium ist hier der Raum selbst. Dadurch schaffen wir die traditionelle Frage nach der Medialität der Kunst ab und ersetzen sie durch die allgemeinsten Bedingungen der Raum/Zeit, durch die allgemeinsten Bedingungen der Wahrnehmung. Habe ich dieses raum-zeitliche Kontinuum geschaffen, kann ich da alles hineinbringen, wenn es nur Zeit und Raum hat. Das hat schon Kant erklärt.
Alles, was wir uns vorstellen, ist immer schon automatisch in einer Raum-Zeit-Konstellation. Wir können zwar von einem bestimmten Raum und einer besonderen Zeitsequenz abstrahieren, aber nicht vom Raum-Zeit-Schema überhaupt.
Dieses kantische Schema eignet sich als Erklärung für die Videoinstallation, für die Installation im Raum. Denn wir haben es hier nach dem Roman mit einer zweiten Kunstform zu tun, die nur mit Raum und Zeit arbeitet. Nur war der Raum des Romans ein idealisierter Raum, während es sich beim Raum der Videoinstallation um einen realen Raum handelt, wenn auch nur als Raum/Zeit-Kontinuität oder als Echtzeitsimulation. In diesem Sinne gibt es keinen Unterschied zwischen einem musealen und einem Bühnenraum. Es handelt sich jedesmal um einen Raum in einem Raum. Wenn wir Video ins Theater bringen, entledigen wir uns einer wichtigen, aber falschen Voraussetzung, nämlich der, daß das Medium des Theaters der Schauspieler sei oder der menschliche Körper. Statt dessen abstrahieren wir die Bühne als einen Raum, wo der menschliche Körper als ein Ready-made unter vielen anderen funktioniert. Wenn ich die mediale Bedingung des Schauspiels oder der Installation oder der Ausstellung nur denke als Zeit/Raum und sonst nichts, ist alles, was darin ist, Ready-made. Alles ist von außen in diesen Raum hineingetragen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen einem Videofilm, den ich dort zeige, einem Stuhl und einem Schauspieler. Der Schauspieler wird genauso in den Raum hineinversetzt wie jeder andere Gegenstand oder ein Videofilm.
Es sind einfach Dinge und Gegenstände, die ich auf die Bühne hole oder in die Installation. Erst indem die Dinge in eine gewisse zeit-räumliche Ordnung gebracht werden, produzieren sie Bedeutung. Aber diese Produktion der Bedeutung ist nicht an sich bedeutsam. Darunter liegt reine Manipulation. Es handelt sich um eine pragmatische, medialisierende Aktion, die schlicht darin besteht, daß ich Dinge von einem Ort zu einem anderen Ort transportiere. Aber diese Orte sind jeweils in sich selber strukturiert. Es gibt Orte der Betrachtung, es gibt Orte der Nichtbeachtung, der puren Zweckmäßigkeit oder der Zerstreuung, es gibt solche und solche Orte. Was ich sagen will, hat vielleicht etwas mit der Relativitätstheorie von Einstein zu tun: Die Unterschiede ergeben sich nicht auf der Ebene der Gegenstände, sondern auf der Ebene der Orte.
Auf der Ebene der Relation der Gegenstände.
Genau. Diese Relationen sind topologisch definiert. Dinge bekommen ihre Bedeutung, bekommen ihre Geschwindigkeiten, bekommen ihre Funktionen dadurch, daß sie Orte wechseln. Durch diese topologischen Verschiebungen schaffe ich die Bedingungen zur Entstehung von Signifikanten. Diese Aktionen produzieren zwar Signifikationen, sind aber selbst nicht signifikant. Sie finden statt auf der submedialen, topologischen Ebene der puren Manipulation, auf Raum und Zeit reduziert. Sonst gibt es keine Bedeutung, keinen Gegenstand, nichts.
Die Differenz, daß es mehr als einen Ort gibt, wird nach Kant schon durch Verstandesleistungen und Schematisierungen – man kann auch sagen: Rahmungen – ermöglicht.
Durch die Schematisierung und durch die Endlichkeit, die eine entscheidende Rolle spielt. Ich habe nicht die Möglichkeit einer unendlichen Betrachtung. Ich bin immer konzentriert auf eine endliche Betrachtung. Ich muß immer auf die Bühne schauen, und wenn ich auf die Bühne schaue, dann schaue ich nur auf diesen Gegenstand; wenn ich auf diesen Gegenstand schaue, schaue ich auf einen anderen Gegenstand nicht. Gerade diese Unmöglichkeit einer Gesamtbetrachtung ist nach Kant die Bedingung der Endlichkeit der Betrachtung.
An die Stelle dieser Fiktion einer Gesamtbetrachtung, die Gott vorbehalten wäre, tritt jetzt die Ordnung nach Perspektiven, nach Kategorien, nach Schematisierungen. Ich stelle mir Verknüpfungen vor, die eine subjektive Gültigkeit haben oder eine intersubjektive, der ich auch das Prädikat „objektiv" zudenken kann, aber nur im Rahmen dieser kategorialen Zeitbestimmungen. Was wird denn aus dem transzendentalen Subjekt?
Das ist klar. Gott, das transzendentale Subjekt und alle anderen Subjekte werden jetzt verkörpert in der Figur des unbekannten Betrachters. So wie es früher den unbekannten Soldaten gab. Der unbekannte Soldat ist sozusagen der Soldat überhaupt.
Das ist das Gegenstück zum Ding an sich.
Wenn ich etwas schreibe oder etwas vorführe, rechne ich mit Freunden, ich rechne mit Kritikern und einem bestimmen Publikum, wie es zum Beispiel Bourdieu beschreibt und so weiter. Doch diese soziologischen Theorien sind zu kurz gegriffen, weil sie die Figur des unbekannten Betrachters nicht mit einbeziehen. Der unbekannte Betrachter ist der Betrachter, von dem ich nicht weiß, ob er mein Werk liest oder betrachtet, und der aus einem Ort kommt, den ich nicht erkennen kann. Dieser Ort ist soziologisch undurchsichtig, unbeschreibbar und liegt hinter dem Horizont dessen, was ich analysieren kann, was ich beschreiben kann. So kann ich nicht wissen, wie der unbekannte Betrachter darauf reagiert, was ich tue. Für einen ägyptischen Steinmetz oder Architekten oder ähnliches, der Pyramiden gebaut hat, ist zum Beispiel der Besucher des Britischen Museums oder des Pergamonmuseums heute ein solcher unbekannter Betrachter. Jeder, der etwas baut, oder generell jeder, der irgend etwas tut, muß damit rechnen, daß ein Betrachter aus einer Zeit oder von einem Ort kommt, die oder der ihm grundsätzlich unbekannt bleiben muß. Trotzdem macht er sein Werk auch für diesen unbekannten Betrachter.
Der Hintergrund des Geschichts- und Kulturrelativismus besteht darin, daß immer eine andere Perspektive möglich ist, die ich nicht mitdenke und nicht mitdenken kann. Das ist aber eine transzendentale Erweiterung des transzendentalen Subjekts im Sinne des Noumenon, des Dinges an sich auf der Betrachterseite. Ein Gedanke, der bei Kant fehlt.
Der unbekannte Betrachter ist das Ding an sich. Bei Kant wird das Ding an sich als etwas gedacht, das hinter dem vermutet werden kann, was wir betrachten, den Erscheinungen. Es wird aber nicht vermutet, daß das Ding an sich uns betrachtet. Daß dieses Ding an sich uns anschaut und beurteilt, nenne ich den submedialen Raum. Es kann passieren, daß wir ihm gefallen oder daß wir ihm nicht gefallen und so weiter, aber wir wissen es im Grunde nicht. Wir ahnen aber, daß wir betrachtet und beurteilt oder sogar verurteilt werden, zumindest, daß wir es werden können. Für diese Möglichkeit steht die Figur des unbekannten Betrachters. Und das Ding an sich ist eine Verkörperung des unbekannten Betrachters. Das macht uns nun einerseits nervös und andererseits sehr gelassen – nämlich in bezug auf unsere Mitmenschen. Denn wir wissen, daß das Urteil unserer Kollegen und des Publikums für uns nicht wirklich interessant und relevant ist. Wirklich interessant ist, was der unbekannte Betrachter über uns denkt und wie er auf das reagiert, was wir machen. Dort entscheidet sich etwas, was mit der Transzendierung unserer Grenzen zu tun hat, weil dieser unbekannte Betrachter uns über die Grenzen dessen führen kann, was wir gewöhnlich mit einem Betrachter verbinden, und damit über die Grenzen dessen, wie wir uns selbst und wie wir unser Werk verstehen. Er kann etwas sehen in uns oder in unseren Werken, was wir aus strukturellen Gründen übersehen haben, was unsere Kollegen und Kritiker übersehen haben, was sich aber plötzlich vom unbekannten Betrachter her als interessant erweisen kann. Dies ist auf der einen Seite wie eine Verdammnis, andererseits aber auch eine Chance, diese Tradition der soziologischen Kunstanalyse und der alten Frage: „Wem dient das, was ich tue?" zu transzendieren und zu sagen, das ist vielleicht interessant für den unbekannten Betrachter. Für ihn arbeite ich. Alle anderen können sich mit dieser Figur identifizieren oder nicht identifizieren, das ist letztlich ihre Sache.
(...)