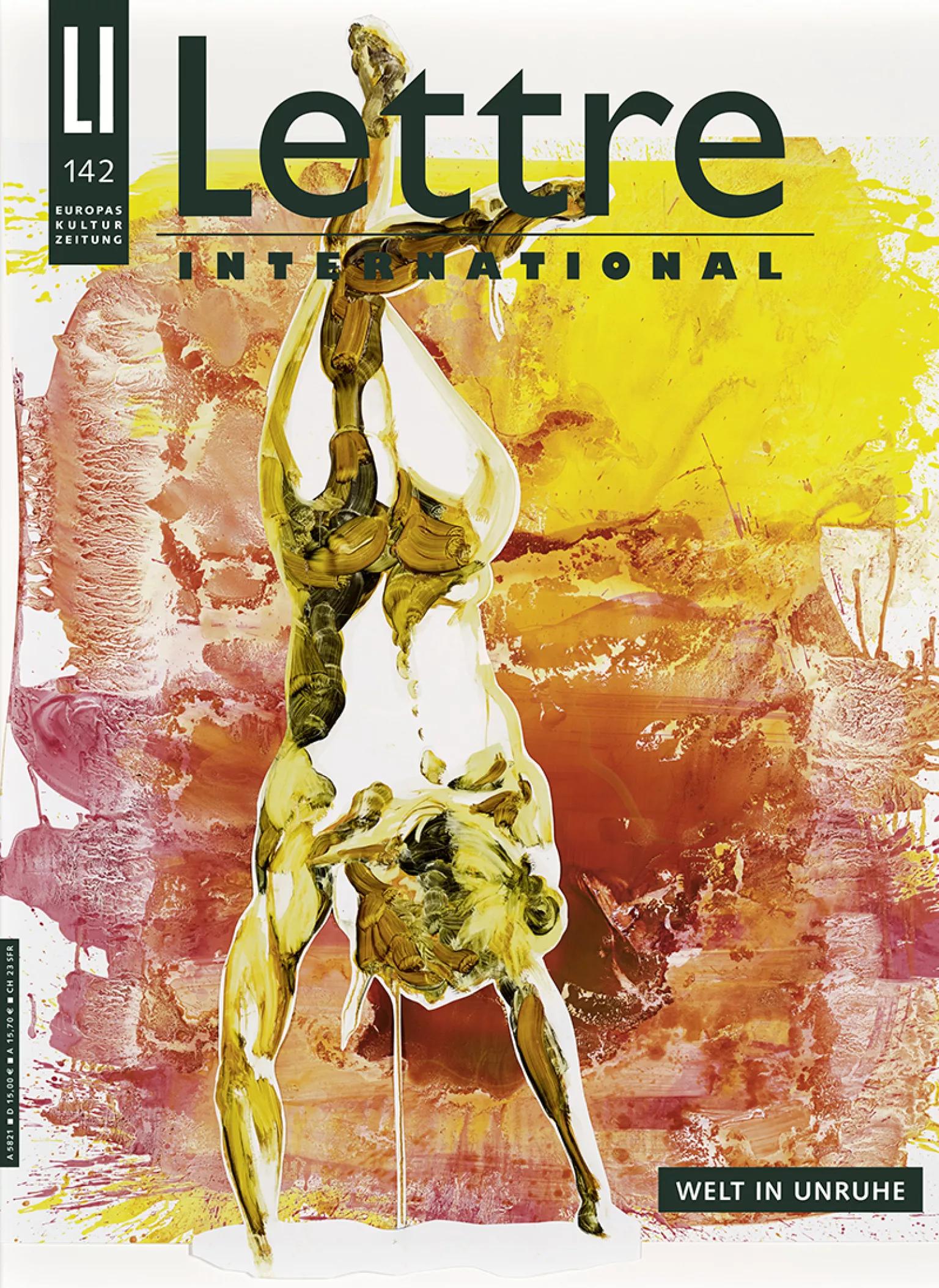LI 142, Herbst 2023
Im magischen Garten
Die Geschichte eines Galeristen im Kunstbetrieb und die KunstwahrnehmungElementardaten
Genre: Gespräch / Interview
Textauszug: 11.236 von 86.594 Zeichen
Textauszug
(...)
GALERIE IN HEROISCHER ZEIT
Axel Ruoff: Bevor du 1988 die Jablonka Galerie gegründet hast, warst du 1987 in Berlin bei Reinhard Onnasch Geschäftsführer. Du hattest Bauingenieurwesen und Kunstgeschichte studiert. Wie wird man da plötzlich Geschäftsführer einer Galerie?
Rafael Jablonka: Durch Witold Gombrowicz.
Axel Ruoff: Durch Frechheit?
Rafael Jablonka: Nein, ich habe damals beim Ludwig-Museum die Ausstellung Europa / Amerika kuratiert. Da rief mich Wolfgang Gmyrek, ein Galerist in Düsseldorf, an: „Reinhard Onnasch sucht für seine Galerie einen Geschäftsführer.“ Ich sah im Ludwig-Museum, daß die meisten Kollegen Schreibtischtäter waren, Kunsthistoriker, die sich im Museum hauptsächlich darum kümmerten, wann sie essen gehen. Um Gottes willen bloß keine Galerien besuchen, das sind ja alles Verbrecher! Diese Einstellung war mir zuwider. Onnasch kannte ich, weil er tolle Ausstellungen gemacht hat und ein toller Sammler war. Ich bin nach Berlin gefahren, aber als ich die zur Galerie umfunktionierte Altbauwohnung mit Raufasertapeten in der Fasanenstraße sah, habe ich gesagt: „Nein, das mache ich nicht“ und bin zurückgefahren.
In dieser Zeit habe ich Gombrowicz gelesen. Ich weiß noch genau, wie ich im Zugrestaurant seine Tagebücher las. Und da stand sinngemäß schwarz auf weiß: „Das Schlimmste, was man machen kann, ist, Pseudointellektueller zu sein.“ Da sah ich mich ganz klar. Ich war nicht dazu geboren, Wissenschaftler zu werden, und meinem Verständnis nach war Museumsarbeit Forschungsarbeit. Wozu sollte ich eine Doktorarbeit über Baselitz schreiben, wenn ich darin nicht aufgehe? Da bin ich im Zug zu diesem Fünf-Mark-Automaten gegangen und habe bei Onnasch angerufen, ob die Stelle noch frei ist. Das war eher ein Notausstieg, denn ich hatte Angst, Pseudointellektueller, Akademiker zu werden.
(…)
EIN TRAUM VON FREIHEIT
Axel Ruoff: Du hast dich mit deiner Galerie nach Amerika orientiert, hast sie mit Mike Kelley und Richard Prince eröffnet. Du bist in Polen aufgewachsen. Welches Bild hattet ihr von den USA und vom Westen?
Rafael Jablonka: Die USA waren eine idealisierte Welt der Freiheit, bildlich dargestellt durch Filme wie Easy Rider. Die Flower-Power-Bewegung war für uns ein Traum von freiem Sex, Drogen und daß man sich vom Establishment befreien und sagen konnte, ich nehme ein Motorrad, haue einfach ab und mache, was ich will.
Mit 15, 16 äußerte sich der Einfluß vom Westen darin, daß man lange Haare, hohe Absätze und diese Glockenhosen mit Schlag trug. Jeans kosteten auf dem Schwarzmarkt einen knappen Monatslohn meiner Mutter. Drogen gab es nicht, man konnte sich besaufen. Neben der Musik von Radio Freies Europa, die durch die Propaganda mit Störgeräten verzerrt wurde, konnten wir so Postkarten, grüne Plastikschallplatten, zum Beispiel mit Procol Harum oder den Rolling Stones, kaufen. Außerdem spielten polnische Bands Rock nach westlichem Muster, und wir waren alle aus dem Häuschen. In der Schule haben wir uns fast geprügelt, weil die einen für Cream waren, das Trio Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker, die anderen für die Beatles – die braven Softies. Wir haben das zugespitzt, wollten Rebellion. Heute würde ich das anders sehen. Aber schon damals war ich immer eher für etwas, was anstrengender war und mir nicht so in den Schoß fiel.
Als wir mit der Schule zu einer Wanderausstellung mit Bildern des polnischen Impressionismus gingen, hat mich am meisten Olga Boznańska beeindruckt, die in Paris gelebt hat; weniger die polnischen Symbolisten, welche die Schule favorisierte, etwa Jacek Malczewski.
Axel Ruoff: Gab es noch andere Filme aus dem Westen, die ihr sehen konntet?
Rafael Jablonka: Wir haben Yellow Submarine und Help, den ersten Film der Beatles gesehen. Auch Easy Rider, Vanishing Point und Filme von Jean-Luc Godard liefen im Kino.
Axel Ruoff: Wann bist du zum ersten Mal in die USA gereist?
Rafael Jablonka: Viele Jahre später, 1979, bin ich mit sehr wenig Geld von Frankfurt aus nach New York geflogen und habe dort einen Monat verbracht.
Axel Ruoff: Wie war dieser Monat? Gab es dort Kontakte?
Rafael Jablonka: Vor der Reise bin ich zu René Block in Berlin gegangen und fragte, was ich da machen sollte. Er hat mir das George-Washington-Hotel, Lexington Avenue, Ecke 21. Straße, empfohlen. Mein kleines Zimmer, mit einem großen Blutfleck auf dem Teppichboden, kostete neunzig Dollar die Woche, die im voraus in bar entrichtet werden mußten. Die Rezeption befand sich hinter einem vergitterten Fenster; für einen Grünschnabel aus Europa eine etwas verstörende Situation. Meine erste Anlaufadresse war Willoughby Sharp, der die berühmte Zeitschrift Avalanche gegründet hatte, die aber damals nicht mehr erschien. Bei ihm im Loft habe ich einen Diavortrag über die verbotene russische Avantgarde gehalten. Nicht über Malewitsch, sondern über die Gegenwart nach 1960, über Kabakov, Infante, Yankelevsky und andere damals in Moskau lebende Künstler. Ich habe viele Ausstellungen gesehen und auch einige Künstler kennengelernt und unter anderen Carl Andre und Sol LeWitt besucht.
(…)
EIN WENIG SCHIZOPHRENIE
Axel Ruoff: Wann hast du die Galerie geschlossen?
Rafael Jablonka: 2017 war endgültig Schluß. Ich hatte 2010 Berlin zugemacht. Dann habe ich die Böhm Chapel gekauft und in der Kölner Galerie eher kleinere Ausstellungen gemacht. Ich hatte noch ein paar Jahre lang in Zürich eine Galerie, aber da war das Interesse nicht mehr da. Die Musik war aus.
Axel Ruoff: Von deiner Seite?
Rafael Jablonka: Von meiner Seite. Ich wollte keine Messen mehr machen, nicht mehr schlaflos in Hotels rumliegen und über den Sinn des Lebens nachdenken. Ich wollte mein Leben, das bekanntermaßen nicht unendlich ist, mit den Leuten verbringen, die ich gerne habe, und nicht die Wichtigtuer, die man heute VIPs nennt und die die Kunst hauptsächlich durch Events kennen, bedienen.
Und es kommt noch ein an mir nagendes Phänomen hinzu: Wenn ich bei einer Ausstellung nichts verkauft hatte, war ich depressiv, weil nichts ging, und das hieß für mich, daß keiner mir glaubt. Wenn ich verkauft hatte, war ich depressiv, weil die besten Stücke, die ich eigentlich behalten wollte, weg waren. Es gab nie eine befriedigende Lösung. Auf Messen war es ebenso, ich war depressiv, egal ob wenig oder vielverkauft wurde.
Axel Ruoff: Du hättest höchstens das sammeln können, was du liebst, und mit dem handeln, was du selbst nicht willst.
Rafael Jablonka: Dann wäre Waffenhandel vielleicht die ideale Lösung gewesen.
Axel Ruoff: Der Sammler und der Händler in dir lagen in stetem Widerstreit.
Rafael Jablonka: Warhols Zehn Porträts von Juden des 20. Jahrhunderts hängen jetzt bei mir. Ich hatte sie auf der Messe hängen, da kommt ein Sammler, will die Arbeit kaufen, und ich sage ihm: „Leider ist sie schon verkauft.“
Axel Ruoff: Obwohl es nicht gestimmt hat?
Rafael Jablonka: Also, ich meine, ist das ein Händler? Das ist eine Lachnummer. Wozu sie dann überhaupt dahin bringen und hängen? Transport, Kisten, extra wunderschön gerahmt. Ich war ein leicht schizophrener Händler. Und das zog sich als roter Faden durch meine ganze Karriere.
Traum braucht Raum, und den gibt es im Handel nicht. Der Kunstmarkt lebt vom Geld, aber die Kunst braucht Zeit, die man nicht kaufen kann.
Axel Ruoff: Du warst dreißig Jahre Kunsthändler. Wie hat sich in dieser Zeit die Galerienlandschaft in Deutschland verändert?
Rafael Jablonka: Deutschland ist nicht symptomatisch. International werden die Galerien immer größere Korporationen, mit Niederlassungen weltweit. 1986 habe ich die Galerie Leo Castelli besucht, den Händler von Jasper Johns, Rauschenberg, Warhol, Lichtenstein, Stella, Flavin, Judd – eine lebende Legende. Aber es war damals nicht so, daß er irgendwo versteckt, von Sekretärinnen abgeschirmt, im Büro saß.
Es war eine andere Zeit. Die Rezeption war nicht am Eingang, sondern hinten, heute undenkbar. Hinter einer Glasscheibe saß Leo, ein älterer, eleganter Herr; er konnte den Besucherverkehr beobachten und gleichzeitig arbeiten. Ich war damals in New York wegen der Ausstellung Europa / Amerika. Castelli schickte mich direkt zu Jasper Johns, dessen Atelier in einem früheren Bankgebäude in East Village war. Castelli wollte, daß ich mir die Seasons anschaute, die Johns gerade malte. Übrigens hing im Atelier gegenüber den Seasons eine große Zeichnung von Eric Fischl, etwa zwei mal zwei Meter.
Heute begegnet man so gut wie niemals dem Galeristen, der auch nicht da sein kann, weil er nicht nur eine Galerie hat, weil er Kunden, unzählige Messen, Biennalen und Ausstellungen seiner Künstler und nicht zuletzt deren Ateliers besuchen muß, die oft Dimensionen von Fabriken haben. Früher war das anders. Ich sage nicht besser. Es gab viel mehr Galerien, die, was heute junge Galerien noch leisten, eine übersichtliche Anzahl von Künstlern vertraten, an die sie glaubten. Heute ist das eine Art Supermarkt, der dir alles besorgen kann. Galerien, die Pionierarbeit leisten, haben das Problem, daß sie die Künstler nicht halten können – das Geld regiert.
(…)
Axel Ruoff: Wenn in der Kunst über Stil gesprochen wird, geht es oft um Wiedererkennbarkeit, also auch den Druck, einen Stil wie ein Produkt zu entwickeln.
Rafael Jablonka: Also ich würde sagen: Die Wiedererkennbarkeit streben große Künstler nicht an, sondern sie ergibt sich aus ihrer Größe. Die von Cézanne ist Jahrzehnte schwerster Arbeit, die Welt, wie er sie sieht, auf Papier und Leinwand zu bringen. Die Suche nach der Wahrheit. Die Originalität kristallisiert sich aus der Suche, dem Werk, auch der Genialität des Produzenten, ob er einen Blick für etwas hat, was uns bisher verborgen geblieben ist. Das muß nicht schrecklich ernst sein, kann auch als Comedy, Persiflage oder Trick erscheinen. Es versteckt sich in so vielen möglichen Äußerungen.
Axel Ruoff: Das macht das Schillern, die Widersprüchlichkeit von Andy Warhol aus.
Rafael Jablonka: Er erschien als Witzfigur, die irgendwelche Platitüden verbreitet.
Axel Ruoff: John Berger, der ja in Frankreich im Gebirge gelebt hat ...
Rafael Jablonka: Eine wunderschöne Geschichte. Ich habe den Roman gelesen.
Axel Ruoff: ... spricht in seinem Text Stilleben über die sich allgemein durchsetzende Akzeptanz von Konsum und Profitstreben. Wer zu dieser ideologischen Niederlage, ja diesem kriminellen Drang beigetragen habe, seien Lichtenstein, Warhol und andere. Wer dagegen Widerstand leiste, sei Barceló.
Rafael Jablonka: Miquel ist ein sehr belesener Künstler und mit vielen, auch bedeutenden Schriftstellern befreundet. Er war auch mit John befreundet. Aber das würde er nicht unterschreiben. Er besitzt Bilder von Warhol. Pop Art ist eine ähnliche Revolution wie der Kubismus. Sie hat die Kunst nicht kommerzialisiert, sondern vielleicht auch ungewollt darauf hingewiesen, daß Kommerzialisierung ein Bestandteil der Kunst ist, und zwar schon immer: Ihr Erfolg und auch ihr Scheitern.
Axel Ruoff: Es geht um das Überschreiten der Grenzen dessen, was und wie zu malen erlaubt ist, auch im Hinblick auf Hoch- und Subkultur.
Rafael Jablonka: Ein Künstler nimmt nichts und macht etwas, das noch nicht da war. Worte, Farben sind nichts oder alles. Mit Farbe kannst du ein Sofa bekleckern oder etwas produzieren, woran zumindest manche von uns glauben. Für manche ist das wichtiger als die Wirklichkeit.
Axel Ruoff: Du hast eine sehr hohe, idealisierende Vorstellung von der künstlerischen Tätigkeit.
Rafael Jablonka: Ja, aber gleichzeitig ist jeder Künstler Handwerker, wie jeder Apostel einen Beruf, zum Beispiel Fischer, Netzmacher oder Zöllner, hatte. Mit der Kunst sind Kenntnisse verbunden, man muß etwas Handfestes machen und kann nicht Geiger oder Literat werden, indem man sich einfach vor ein Blatt Papier setzt und sagt, jetzt schreibe ich. Also Fleiß, Fleiß, Fleiß und dazu ein Hauch, ein unhörbares und unsichtbares Etwas.
(…)