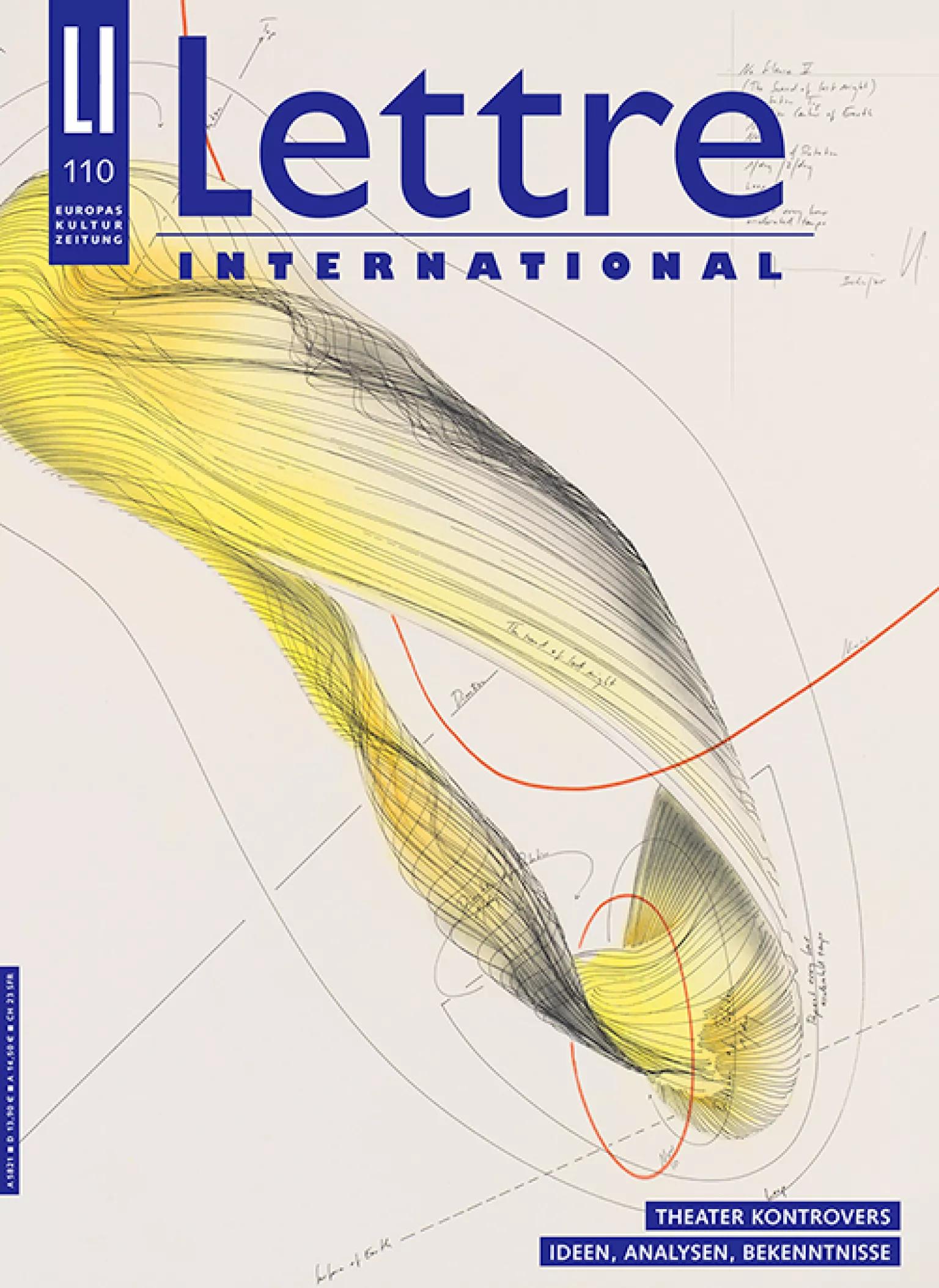LI 110, Herbst 2015
Die Macht Shakespeares
Vom kleinen Leben und vom Träumen zwischen Schlaf und SchlafElementardaten
Genre: Essay
Übersetzung: Aus dem Spanischen von Ulrich Kunzmann
Textauszug: 3.606 von 37.060 Zeichen
Textauszug
(…)
Die Frage der Macht bei Shakespeare war eines der Probleme, die im Lauf der Jahrhunderte am meisten fasziniert haben. Den meisten seiner Stücke liegen politische Intrigen zugrunde, ihre Hauptpersonen sind Könige und Prinzen, sie dramatisieren Kämpfe um die Staatsherrschaft, tödliche Erbschaftsstreitigkeiten, Treulosigkeiten, Abdankungen und Verschwörungen. Aus der Wahl dieses Milieus wollte man oft ein Urteil über Monarchie oder Totalitarismus, Plebejer und Aristokratie ableiten. Abraham Lincoln behauptete zum Beispiel, es gebe keine bessere Analyse der Folgen einer Tyrannei als die Lektüre von Macbeth – aber wer ist ein größerer Tyrann, Macbeth oder Julius Cäsar, Heinrich IV. oder Heinrich V., Richard III. oder Coriolan? Sind für Shakespeare alle Politiker verdorben? Glaubte der Dichter, das Volk sei ein Idiotenhaufen? Inszenierungen, die eine einseitige Sicht des Menschen und der Gesellschaft im Werk Shakespeares verteidigen sollen, führen regelmäßig und vielsagend zu einem peinlichen und lächerlichen Ergebnis.
Damit man jeden Aspekt seines Schaffens untersuchen kann – und nachdem man anerkannt hat, daß dieses sich unmöglich domestizieren läßt –, erweist es sich als unumgänglich, das Gesamtwerk als Fuge anzusehen, ohne zwischen einzelnen Genres – eine weitere Taxonomie, die er offenkundig vernachlässigte – oder zwischen unterschiedlichen historischen bzw. soziologischen Hintergründen zu unterscheiden. Shakespeare bekundete stets unmißverständliche Geringschätzung gegenüber allen Konventionen, und ihm war auch stets bewußt, daß der reale Inhalt nichts mit realistischer Rhetorik zu tun hat. In diesem Sinne kommt es nicht allzusehr darauf an, ob seine Dramen im klassischen Rom (wo sich eine unzeitgemäße Uhr melden kann), in einem kanallosen Venedig oder in einer Hafenstadt Mailand spielen. Und wenn er sich nicht um solche Kleinigkeiten kümmerte, gab er sich auch keine Mühe, eine bestimmte, im voraus konstituierte politische Ethik widerzuspiegeln oder ein Beispiel für eine gute Regierung vorzustellen. Nicht einmal der Machiavellismus – eine europäische Denkrichtung, die nichts mit Machiavelli zu tun hat – hatte seine Vorstellungen wirklich beeinflußt, wenn man von irgendeinem bombastischen Kunstgriff am Beginn seiner Laufbahn absieht.
(…)
Mehr als für die Machtpraxis scheint sich Shakespeare für die Unterbrechung der Machtausübung und die Umstände zu interessieren, die den Regierenden zwingen, Schluß mit der gewohnheitsmäßigen, unreflektierten Herrschaft zu machen und die Handlungsenergie auf eine vor kurzem entdeckte Innerlichkeit auszurichten. Er stellt sich stets das Ende eines Zeitalters vor (das Licht der Dämmerung, scheint er uns mitzuteilen, erlaubt uns als einziges, klar zu sehen) und wirkt in einem Reich, in dem – sowohl im geistigen als auch im amourösen oder politischen Bereich – Extreme koexistieren. In seinen Stücken funktioniert das Übernatürliche gewöhnlich als Auslöser eines menschlichen Sturms, den man dann ohne die Hilfe einer Gottheit bewältigen muß, da diese plötzlich verstummt ist. Als er sich mit dem Problem der Liebesbeziehungen auseinandersetzte, räumte er, wie dies bis dahin niemand gewagt hatte, mehrere Jahrhunderte einer Troubadourrhetorik nachdrücklich beiseite und schlug eine neue Sprache für eine gemeinsame Erfahrung vor. Und in der Machtsphäre entdeckte er ein Problem, das danach die Moderne hervorbringen sollte und das mit der Autoritätskrise zu tun hat, die tatsächlich mit einer natürlichen Unmöglichkeit der Macht einhergeht. Bei alldem bleibt Shakespeare, um es mit Emily Dickinson zu sagen, unsere Zukunft.
(…)