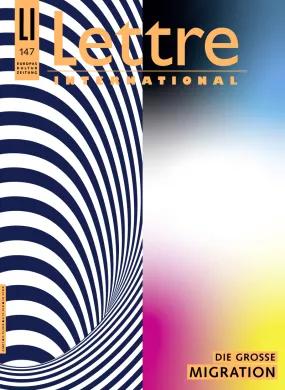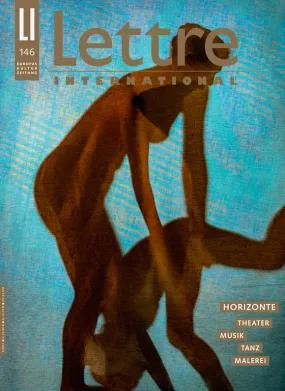LI 58, Herbst 2002
Dschenin
Elementardaten
Genre: Bericht / Report, Erzählung
Übersetzung: Aus dem Französischen von Ulrich Kunzmann
Textauszug
Eine Frau sitzt in den Trümmern.
Ihr schwarzes Kleid ist mit grauweißem Staub bedeckt. Ihre dicken Hände wühlen im Schutt.
Sie sitzt auf einem Stein und starrt in die Ferne. Ringsum Steine, Bruchstücke eines nicht vollständig zerstörten Hauses, durchlöcherte Mauern, Eisenstangen, Überreste von Türen, Fenstern, Teile eines vernichteten, abgebrochenen Lebens.
Aus Steinchen und Staub zieht ihre rechte Hand einen Kinderschuh hervor. Er ist aufgeschlitzt und zerfetzt. Sie untersucht ihn. Mit der anderen Hand verscheucht sie die Fliegen. Sie hält sich die Hand vor Nase und Mund.
Sie spricht:
Das ist der linke Fuß. Der Fuß eines jungen Mannes oder Mädchens. Ein Schuh von jungen Leuten. Tennisschuhe, sagt man. Aber wo ist der andere? Von den Katzen aufgefressen. Genau, von den Ratten aufgefressen. Den hier lege ich beiseite. Man braucht ihn bloß zu nähen, ihn ein bißchen zu flicken, ich gebe ihn dem Schuster. Vorläufig hebe ich ihn auf, man weiß ja nie, für den Fall, daß der Junge nach ihm sucht. Dann würde sein rechter Fuß in einem Schuh stecken, und der andere wäre barfuß. So was bringt Unglück; es bedeutet, daß er seine Mutter oder seinen Vater verliert. Wenn er nicht kommt, hat ihn das Unheil erledigt und ihm das Schicksal eines Waisenkinds erspart. Trotzdem, ich lege den Schuh beiseite, da zwischen den großen Steinbrocken und den Eisendraht. Der Schuster hat bestimmt zumachen müssen…
Wie heißt der Junge mit dem Schuh? Georges? Ismaël? Ach was, ich nenne ihn Ali. Die Soldaten, die uns kaputtmachen, haben große Füße.
Wo bin ich? Verrückt, daß ich mich die ganze Zeit frage, wo ich stecke. Nie konnte ich mich zurechtfinden, aber hier, das muß man sagen, hat die Frage einen Sinn. Wer könnte mir verraten, wie der zerstörte Ort hier heißt, dieser Ort, der keinem anderen gleicht, vielleicht ist es die Stätte des Nichts, ein Stück Wüste, das Ende der Stadt…
Meine Augen verraten mich. Ich sehe und sehe nicht.
Was ich sehe, gibt es nicht mehr.
Ich sehe ein Haus. Es steht da. Es ist stehengeblieben. Die Mauern sind Mauern. In den Mauern sind Fenster.
Ich sehe einen Baum mitten im Haus. Einen Zitronenbaum oder einen Ölbaum. Ich kann es schlecht unterscheiden.
Die Mauern sind blau gestrichen. Die Fensterläden stehen offen. Sie sind weiß. Es ist heiß. Ich sehe eine Tür. Sie ist nicht besonders stabil. Ich sehe ein Dach mit roten Ziegeln. Nein, da irre ich mich. Bei uns hat es nie Dachziegel gegeben, keine roten und keine grünen.
Das Haus steht offen.
Es riecht nach Essen. Aber da kocht niemand. Alle sind fort. Und ich bin da. Was tue ich hier? Ich weiß es nicht. Ich suche. Ich rede dummes Zeug. Ich suche unter den Steinen, die der Regen heruntergerissen hat.
Meine Augen werden leer. Ich spüre, daß mir Bilder aus den Augen fallen und sich mit dem Staub vermischen. Ich lasse sie zerrinnen. Es ist besser, daß sie verschwinden. Ich halte sie nicht zurück, sonst kann ich nicht schlafen. Aber wer redet vom Schlafen? Das Bett ist ein Lager aus dichtem Staub. Dieser Staub verschlingt unser Schlafbedürfnis. Sobald man sich rührt, wirbelt er hoch wie eine Wolke und überzieht mich, bis er mich blind macht.
Warum gibt es so viele Fliegen? Sie sind dick und zudringlich. Eine tote Katze? Nein, das ist keine Katze, das ist eine alte Puppe, die man da vergessen hat. Sie blutet. Sie weint. Ich werde doch nicht mit einer Puppe spielen! Aus dem Alter bin ich heraus, aber ich habe überhaupt kein Alter mehr. Sie haben es mir weggenommen. Sie haben es zusammengefaltet und in einen Jutesack gesteckt.
Da, eine Hand!
Eine Männerhand.
Sie bewegt sich. Der Zeigefinger deutet auf etwas. Ich sehe nichts.
Es ist eine Hand aus Wachs. Sie ist von einem Körper abgerissen.
Sie schwitzt.
Aber warum bewegt sie sich?
Meine Augen täuschen mich.
Der Staub dringt überall ein. Er ist unter der Haut, im Hals, in den Adern, in den Träumen.
Ich bin bis zum Platzen voll mit Staub. Man könnte sagen, es wäre Asche. Ich unterscheide nicht mehr zwischen beidem.
Ein Photo. Es ist beinahe unbeschädigt. Ein alter Mann, den seine Frau und seine drei Töchter umgeben. Keine Jungen. Oder sie waren nicht da, als die Aufnahme gemacht wurde. Der Mann sieht gut aus, ein bißchen steif. Man könnte ihn für eine Statue halten. Das ist normal, er posiert für die Zeit, für die Ewigkeit. Aber wo sind sie jetzt? Wer ist die Frau? Wie heißt sie? Sie ist noch jung. Woran denkt sie? Vielleicht an ihre abwesenden Jungen.
Der Mann ist wahrscheinlich tot.
Doch wenn er tot ist, wo ist dann die Frau, was ist aus den Kindern geworden? Sie sind groß; sie lernen oder arbeiten auf der anderen Seite der Grenze. Bald kommen sie heim. Am Abend dürfen sie sich nicht auf den Straßen herumtreiben. Das nennt man Ausgangssperre.
Verrückt, was man alles unter den Steinen findet.
Einen Schlüssel.
Einen altmodischen Schlüssel. Er ist groß.
Was kann man mit ihm aufschließen?
Vielleicht ist er der Schlüssel zum Paradies.
Als ich klein war, legte mir mein Vater immer einen Schlüssel unters Kopfkissen. Er sagte: "Damit kannst du die Tür zum Paradies aufmachen, wenn du in deinen Träumen unterwegs zu den blühenden Gärten bist." Das habe ich geglaubt. Den hebe ich auf. Ich stecke ihn in die Tasche, für den Fall, daß meine Füße zur Schwelle des Paradieses rutschen.
Ich habe Durst. Ich sehe einen Springbrunnen. Das Wasser ist versiegt, die Katzen haben das ganze Wasser ausgetrunken. Das erzählt man. Man erzählt viel. Ich rühre mich nicht fort. Ich bleibe da. Ich habe keinen Durst mehr. Ich habe keinen Hunger. Ich suche nach meinem Haus. Der Stein hier hat zur Seitenwand meines Hauses gehört. Ich erkenne ihn wieder. Er ist nicht wie die anderen. Ich behalte ihn da. Ich verstecke ihn unter meinen Füßen. Den nimmt mir keiner weg. Das ist mein Stein, ein kleines Stück von meinem Haus. Später pflanze ich ihn ein. Aus ihm wächst ein Baum für mich, der Baum gibt mir Schatten, und dann lebe ich unter meinem Baum.
Blödsinn, was ich da erzähle. Einen Stein pflanzen; aus so einem ist nie etwas gewachsen. Aber wenn ich ein Haus habe, habe ich das Recht auf einen Baum. Ich möchte gern einen Ölbaum haben.
Schweigen. Die Frau blickt hoch. Sie hört Stimmen in der Ferne.
Man vernimmt die ruhige und feste Stimme eines alten Mannes. Er erzählt:
"Wir waren alle zu Hause; Mahmoud, der seit ein paar Monaten krank war, sagte nichts: Er drückte den Kopf an die Wand und stöhnte wie ein Tier. Wenn er leidet, fühlt er sich unglücklich und röchelt wie ein verletztes Tier. Mahmoud hatte kein Glück, er konnte nicht zu einem Arzt. Er spürte die nahende Gefahr. Er hatte den Instinkt eines Tieres. Plötzlich sind die Planierraupen gekommen. Sie machen entsetzlichen Krach. Wenn sie vorrücken, zermalmen sie alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie haben die Mauern des Hauses eingerissen. Wir sind durch die Küchentür hinausgelaufen und haben bei meinem Bruder im Haus nebenan Zuflucht gesucht. Es fiel Mahmoud schwer aufzustehen. Er drückte seinen Körper an die Wand. Ich dachte, daß er nachkommen würde. Aber er hat sich nicht von der Stelle gerührt. Die Raupe hat ihn zerquetscht. Nachdem sie unser Haus eingerissen hatte, ist sie weitergefahren und zu meinem Bruder gekommen. Da sind wir mit erhobenen Händen hinausgelaufen und haben geschrien: "Wir sind da drin, wartet! Wir sind da drin, da sind Frauen und Kinder!" Unsere Schreie konnten nicht viel ausrichten gegen die riesige Maschine, die alles niederwalzte. Die Soldaten haben mich aufgefordert, ich sollte zu einem Panzer gehen und dabei das Hemd hochstreifen, damit zu sehen war, daß ich keinen Sprengstoff bei mir trug. Sie haben mir die Hände zusammengebunden, und danach, als ich ihnen sagte, wie alt ich bin, haben sie mich gehen lassen. Ich wußte nicht, wohin ich sollte. Ich hatte kein Zuhause mehr, überall waren Panzer. Einer davon hat mich in einem Gang des Lagers gestellt. Die Soldaten haben mich aufgefordert umzukehren. Da stand ich vor einem anderen Panzer, der mir befohlen hat zu verschwinden. Ich konnte nirgends hin. Ich habe an eine Haustür geklopft. Das Haus war voller Soldaten. Ich habe sie gebeten, mir zu helfen; sie haben mir gesagt, ich sollte woanders hingehen, das sei nicht ihr Problem. Ich habe sie gefragt, ob sie Mahmoud gesehen hätten, einen kranken Mann. Sie haben mir noch einmal geantwortet, das sei nicht ihr Problem. Ich habe in den Trümmern nach Mahmoud gesucht. Die Soldaten haben geschrien und gedroht. Ich wußte nicht, wie ich aus dieser Hölle herauskommen sollte. Ich bin im Kreis gelaufen. Erst am Tag darauf konnte ich ins Nachbardorf gelangen. Ich habe Mahmoud nicht wiedergesehen. Vielleicht wurde er gerettet. Er ist im Paradies. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Ich bleibe da und warte. Ich warte auf meine Frau und meine Kinder, auf Gerechtigkeit."
(...)