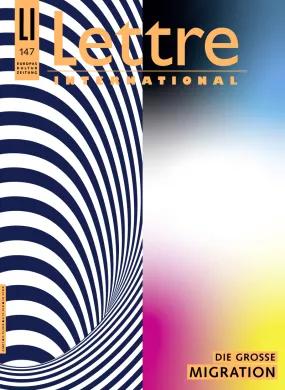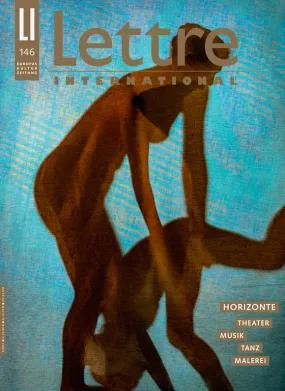LI 62, Herbst 2003
Jagd und Flucht
Die Schliche der Wilderer in ChinaElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Chinesischen von Michaela Zocholl
Textauszug
Endlich: Der Laut, auf den die Wilderer so lange gewartet hatten, erklang. Man darf ihn sich jedoch nicht als ein im Umkreis von 100 Metern deutlich hörbares, von einer Bewegung verursachtes Geräusch vorstellen, denn tatsächlich können diesen Laut nur erfahrene Jäger hören. Ich sage zwar "hören", aber eigentlich müßte man es eher "spüren" nennen. Ich selbst habe unzählige Male auf ihr Zeichen hin die Ohren gespitzt, den Kopf in alle Richtungen gedreht und doch nicht gehört, daß sich ein Tier fast unmerklich näherte. Nach vielen Jahren intensiver Übung habe ich begriffen, daß "wahrnehmen" viel eher zutrifft als "hören". Es ist ein Laut, der entstehen kann, wenn einige Zweige geknickt oder gestreift werden, ohne daß man genau sagen könnte, woher er rührt. Es ist nur ein vager Anhaltspunkt, der dich ahnen läßt, ob es ein Reh, ein Rothirsch oder eine Gazelle ist, die sich dir nähert. Es ist die Ahnung eines Raschelns, wenn das hohe Gras die Flanken des Tiers streift, oder des Tropfens von Wasserperlen, die von den Hufen des Tiers herabrollen. Du darfst dich dann nicht bewegen, damit du genau hörst, ob das Tier sich direkt auf dich oder auf deinen Gefährten zubewegt oder ob es, mißtrauisch geworden, verharrt und wittert.
Wenn deine Einschätzung stimmt und sich das Wild in Reichweite deines Gewehrs befindet, dann ist der Moment gekommen, den Abzug zu drücken. Häufig befinden sich die Wilderer in der Situation, daß sie die Gestalt des Wilds nicht ganz erkennen und sie sich beim Schießen allein auf ihr Gefühl verlassen müssen. Dies trügt sie jedoch fast nie, und sie treffen das Wild präzise und tödlich. Vielleicht ist das ja einer der Unterschiede zwischen Wilderern und Hobbyjägern.
Hao bewegte den Kopf sachte in beide Richtungen, sein Zeigefinger krümmte sich, er visierte sein Ziel an und drückte ab. Im dichten Gras vor ihm war weder ein Laut zu hören gewesen noch die kleinste Bewegung eines Tiers zu spüren – es war totenstill. Und doch wußte ich, daß ihm die Beute sicher war. Der Schuß hallte fürchterlich im morgendlich dämmrigen Tal. Es klang, als würde ringsum geschossen. Tatsächlich war es aber nur das Echo des einzelnen Schusses, den Hao soeben abgefeuert hatte, das die umliegenden Berge vielfach zurückwarfen. Wir hatten beinahe das Gefühl, in einen Hinterhalt geraten zu sein und aus allen Richtungen beschossen zu werden.
Bei dem Schuß hoben mehrere Rehe die Köpfe aus dem tiefen Riedgras, reckten erschrocken die Hälse und lauschten reglos, um herauszufinden, woher Gefahr drohe und aus welcher Richtung der Schuß gekommen sei.
Ein solcher Moment dauert nur etwa drei Sekunden, danach scheint es nicht mehr wichtig, woher die Gefahr wirklich kommt, und sie beginnen, kopflos in die scheinbar sicherste Richtung zu fliehen. Dann erst wird deutlich, was mit "über das Gras fliegen" gemeint ist. Es sind diese drei Sekunden, in denen die Wilderer nie ihr Ziel verfehlen.
Im selben Augenblick, als sich das Rudel Rehe noch umsah, knallten auch die Gewehre von Bao und Chai, und ein Tier stürzte zu Boden. Ein anderes Tier sprang aus dem dichten Gras heraus mehr als einen Meter in die Höhe, strauchelte, sprang wieder auf und flüchtete am Rand eines Schilfgürtels entlang.
Jetzt war das gesamte Rudel in Aufruhr. Sie sahen die Stelle, an der das eine Reh gestürzt war, und erkannten, von wo die Schüsse gekommen waren; nun wußten sie, wohin sie fliehen mußten. Der Anblick der Tiere glich einer Brandungswelle über dem Schilfgras.
Die Fluchtbewegung eines Rudels Rehe ist einzigartig. Sie tauchen wie ein Schwarm Delphine über der Grasfläche auf, dann verschwinden sie gemeinsam wieder in der Fläche. Tauchen wieder auf, und mit jedem Sprung fliegen sie leicht zwölf Meter weit. Nach etwa zehn Sprüngen sind die Rehe bereits außer Sichtweite. Manchmal reicht nicht einmal die Zeit, das Gewehr neu zu spannen.
Als erfahrene Wilderer hatten Hao, Bao und Chai jedoch die letzte Gelegenheit genutzt und drei Rehe in der Luft erlegt. Drei Leiber stürzten aus der Luft und schlugen klatschend in den Fluß. Die übrigen Rehe flüchteten nur um so schneller.
Ich fragte mich, ob angeschossene Rehe ihren schon erkaltenden Leib einsetzen, um ihren Artgenossen einen letzten Dienst zu erweisen. Das pfeilschnell fliehende Rudel bot einen eindrucksvollen Anblick: Es schien, als wären im hohen Gras zahlreiche Figuren aus einer altertümlichen Oper versteckt, die alle gleichzeitig ihre schneeweißen Taschentücher gen Himmel schwenkten. Ein weißes Tüchlein nach dem anderen hob sich empor und verschwand dann, immer wieder, ein atemberaubender Anblick, bei dem einem vom Zusehen der Kopf schwirrte. Dieser Eindruck entsteht durch den Spiegel der Rehe, zwei halbkreisförmige Flecken weißen Fells zu beiden Seiten des Afters, die zusammen so groß sind wie ein Taschentuch.
Keiner weiß wirklich, warum Rehe am Hinterteil diese weißen Stellen haben und warum sie von so blendend weißer Färbung sind. Dienen sie dazu, auf der Flucht die Aufmerksamkeit der nachfolgenden Tiere auf dieses Zeichen zu lenken, damit die Herde sich nicht zerstreut?
Hao, der erfahrene Wilderer, hatte es mir jedenfalls so erklärt. Seine Erklärung erschien mir angesichts der geschlossenen Flucht des Rudels sehr einleuchtend.
Rehe haben einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Wir Menschen haben jedenfalls keine Entsprechung zu diesen weißen Stellen.
Schnell hatten Hao und Bao die erlegten Rehe gefunden, die im Schilf lagen und aus deren Mäulern Blut rann. Eines war in den Hals getroffen worden, das andere direkt ins Herz. Das dritte Reh, das ebenfalls in den Fluß gestürzt war, war auch ins Herz getroffen worden. Bao blieb zurück, um sich um die Beute zu kümmern. Hao, Chai und ich machten uns auf die Suche nach dem verwundeten Reh, das geflohen war.
Chai zeigte uns die Stelle, an der jenes Reh gestürzt war und sich dann wieder aufgerappelt hatte. Wir sahen, daß einige Schilfhalme umgeknickt waren, es waren jedoch keine Blutspuren zu sehen. Hao sagte: "Wenn es hier gestürzt ist, aber kein Blut zu sehen ist, kann es nicht weit gekommen sein. Es ist nicht tödlich getroffen, hat aber auch keine leichte Verletzung. Eine oberflächliche Verletzung hätte sicherlich geblutet. Wenn es nicht blutet, aber stürzt, wurde es vermutlich in den Leib getroffen, denn mit einer Beinverletzung hätte es nicht so schnell fliehen können."
Die Fährten von Rehen sind für die meisten Wilderer nicht leicht zu lesen. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, daß auf ebener Steppe schon ein Hase fünf bis sechs Meter weit springt. Steht man dann an der Stelle, von der er abgesprungen ist, so ist es sehr schwer, im Umkreis von fünf Metern die Stelle zu finden, an der er nach dem Sprung gelandet ist. Für Menschen ohne ausreichende Erfahrung ist es fast unmöglich. Doch hier im weiten tiefen Gras liegen zwischen Absprung und Landung über zehn Meter. Außerdem ist der Landepunkt nicht, wie man vielleicht denken könnte, eine Stelle mit auffällig niedergedrücktem Gras.
Manchmal sind dort nur wenige Halme geknickt. Und auch diese sind nicht wichtig; worauf es ankommt, ist die Stelle, wo das Tier die beiden Vorderhufe nach hinten gebracht hat, und die Richtung, in der sich die Hinterhufe nach vorn abgedrückt haben. Die Fluchtrichtung kann man einschätzen, wenn man die Tiefe des Hufabdrucks in der Erde betrachtet und genau beachtet, in welche Richtung ein wenig Erde aufgeschleudert wurde. In diese Richtung muß man gehen, egal welche Hindernisse auf dem Weg liegen, man darf keinesfalls abweichen. Schließlich legen Rehe die größte Strecke ja in der Luft und nicht auf dem Erdboden zurück.
Nachdem Hao den Ausgangspunkt gefunden hatte, schlossen Chai und ich auf und folgten der angegebenen Richtung.
Die beiden hatten ihre Gewehre bereits wieder gesichert.
Wenn nach der Beute gesucht wird, ist die Gefahr am größten, daß die Jäger sich versehentlich gegenseitig verletzen. Im Vorjahr war es passiert, daß Chai, der nach einer angeschossenen Gazelle suchte, auf dem kahlen Schädel von Bao beinahe einen zweiten Hongqikanal gegraben hätte.
Es war ein klarer Morgen gewesen, in der Nacht zuvor hatte es geschneit. Hao hatte nachts Wildhasen gejagt und dabei im Schnee Spuren von Gazellen gefunden, wovon er Bao und Chai berichtete. Am Morgen brachen die beiden mit ihren halbautomatischen Gewehren auf. Sie hatten keinen Grund, an Haos Fähigkeiten als Spurenleser zu zweifeln und sichteten auch schon bald eine einzelne Gazelle. Selbstverständlich brachte Bao das Tier mit dem ersten Schuß zu Fall. Doch als die beiden Männer den Hügel hinunter zu der Stelle liefen, war von der Gazelle kein Schatten mehr zu sehen. Auf dem Schnee gab es jedoch Hufabdrücke, und es war zu erkennen, in welche Richtung sie geflüchtet war. Mit dem Gewehr im Anschlag folgten sie der Blutspur hintereinander im Abstand von 20 Metern. Tatsächlich war die Spur auf dem Schnee leicht zu unterscheiden, und sie ahnten bald, wo die Gazelle sich versteckte. Was sie nicht ahnten, war, daß die Gazelle einmal in schrägem Winkel gesprungen war und sich seitlich von ihnen hinter einem Gebüsch verbarg. Bao ging voraus und befand sich links von der Gazelle. Chai kam von rechts auf sie zu, doch keiner der Männer wußte, daß sie sich bereits zwischen ihnen befand. Die Gazelle aber fühlte sich von zwei Seiten angegriffen.
Plötzlich sprang sie trotz ihrer Verwundung wieder auf. Vielleicht überschätzte sie die eigene Sprungkraft, vielleicht konnte sie auch einfach nicht einschätzen, wie stark die Wunde sie behindern würde. Jedenfalls gelang ihr kein besonders weiter Sprung, und sie knallte mit dem Kopf gegen Chais ungeschützten Schädel. Chai trug von diesem Stoß eine blutige Nase und schwere Prellungen im Gesicht davon. Vor Schreck wäre ihm beinahe die Seele entfleucht. Sein Zeigefinger verkrampfte sich am Abzug des ungesicherten Gewehrs und löste einen Schuß aus.
Die Gazelle ihrerseits hatte beim Zusammenprall einen lauten Schrei ausgestoßen, der den vorneweg gehenden Bao unwillkürlich herumfahren ließ. Der Anblick ließ ihn erbleichen. Chai und die Gazelle waren zusammen auf den verschneiten Boden gestürzt, und der Lauf von Chais Gewehr war direkt auf seinen Kopf gerichtet. Er wußte zwar nicht, daß Chais Gewehr nicht gesichert war, doch ließ er sich in einer Art instinktiver Geistesgegenwart in den Schnee fallen, genau in dem Augenblick, als sich der Schuß aus Chais Gewehr löste. Die Kugel zischte haarscharf über Baos blanken Schädel hinweg.
Später erzählte Bao, daß er in diesem Moment sein Leben habe enden fühlen. Er wurde ohnmächtig. Als er wieder zu sich kam, wagte er nicht, sich an den Kopf zu fassen, denn er fürchtete, dort eine blutige Verletzung oder seinen Schädel zerschmettert zu finden. Chai kam angerannt, half ihm auf die Füße und tastete seine Glatze mit den Händen ab. Es waren aber weder innere noch äußere Verletzungen festzustellen, nur ein dunkler Streifen, der längs über den Kopf führte und von dem nicht festzustellen war, ob er daher rührte, daß Bao bei seinem Sturz einen Ast gestreift hatte, oder ob sie tatsächlich von der über seinen Schädel pfeifenden Kugel verursacht worden war.
Bao bestand darauf: "Das ist die Spur der Kugel." Chai widersprach: "Übertreib nicht. Eine Kugel hätte mindestens eine schwarze Rille hinterlassen."
Zwischen Jägern und Gejagten geschehen viele seltsame Dinge, die auf ihrer tiefen Feindschaft gründen. Menschen, die an die Vorsehung glauben, sagen, ein solches Ereignis habe etwas mit höherer Gerechtigkeit zu tun. Noch ein halbes Jahr nach dem Zwischenfall klagte Chai über nervöse Zustände, so daß seine Frau ihn beinahe in eine Nervenklinik eingeliefert hätte. Abergläubische sagten, daß er von einem Berggeist verwirrt worden sei, daß er einem Dämon begegnet oder vom Geist der Gazelle besessen sei. Auch der eigentlich erfahrene Bao erlitt in der Folgezeit, als er einmal dabei war, seine Beute zu holen, einen schlimmen Unfall, der uns sehr erschreckte. Es fehlte nicht viel, und wir hätten ihn in der Erde begraben müssen.
(...)