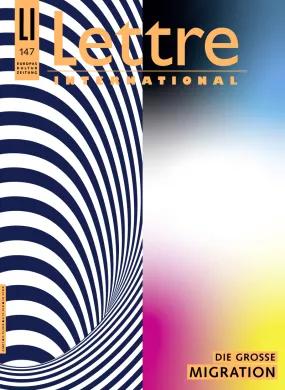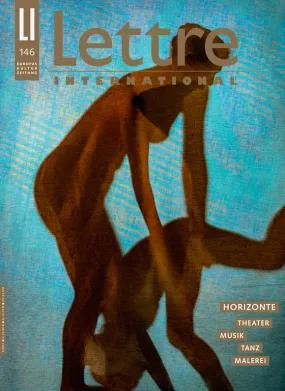LI 70, Herbst 2005
Schiffsverschrotter
Die Abwracker von Alang und die Anarchie der MeereElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Textauszug
Kapitän Vivek A. Pandey fand, er hätte Kampfpilot werden können. Da sein Vater vor der indischen Unabhängigkeit für die Briten geflogen war, sagte sich Pandey, ihm liege das Fliegen im Blut. Als junger Mann hatte er den indischen Tauglichkeitstest für Piloten absolviert und die Prüfer mit seinem räumlichen Orientierungsvermögen, seiner instinktiven Beherrschung der Fluginstrumente und seinen zuverlässigen Reaktionen beeindruckt. Sie sahen, was er bereits wußte – daß er mit starken Nerven geboren war. Als er zur See ging, lief er daher vor nichts davon, sondern traf eine Wahl. Er erklärte es mir mit einem Spruch: „Von der Luftfahrt zur Seefahrt“ – als gäbe es da keinen großen Unterschied. 17 Jahre lang durchpflügte Pandey auf Frachtschiffen und Tankern unter vielen Flaggen den Ozean. Er wurde Kapitän und lebte an Bord in Kajüten, von denen ihm manche luxuriös wie Hotelsuiten schienen. Er fuhr Norfolk, Savannah und Long Beach sowie sämtliche großen Häfen Europas an. Ihm behagten die Sauberkeit auf dem Schiff und die Befehlsgewalt eines Kapitäns, doch irgendwann heiratete er und spürte die Verlockungen der Häuslichkeit. Vor 13 Jahren, nach der Geburt einer Tochter, ließ er sich im Staat Gujarat nieder, an der westlichen Küste Indiens.
Ich traf ihn dort in den dunklen Stunden vor Einsetzen der Winterdämmerung an einem Strand namens Alang – ein mit Industrieschrott übersäter Küstenstreifen am öligen Golf von Cambay, einem Teil des Arabischen Meeres. Man hatte mich gewarnt und mir gesagt, daß Pandey etwas gegen mich haben, daß er mich für einen aufdringlichen Westler halten würde, doch habe ich nichts davon bemerkt. Er war ein kräftiger Handelskapitän mittleren Alters in sauberen Khakihosen und Tennisschuhen, eine Baseballmütze auf dem Kopf, und er kehrte den ruhigen, geschäftsmäßigen Seemann heraus, der einen Job zu erledigen hat. Inmitten einer Gruppe zurückhaltender, etwas rauhbeinig aussehender Männer, manche mit Turbanen und in traditionelle Lungis gekleidet, nahm er das Angebot an, mit ihnen Kokosnußstücke und Tee zu teilen. Er sah auf die Uhr. Er blickte hinaus auf die dunkle See.
Die Flut hat das Meer um gut zehn Meter ansteigen lassen, weshalb das Wasser fast einen halben Kilometer tiefer landeinwärts reichte und hoch hinauf an den Rand des Strandes schwappte. Zwei Schiffe lagen an der dunklen Küste vor Anker, waren aber nur an ihren Mastlichtern zu erkennen. Das erste war ein 170 Meter langer Frachter namens „Pioneer 1“ mit Heimathafen St. Vincent in der Karibik. Pandey hob ein Funkgerät an die Lippen, nannte sich „Alang Control“ und sagte: „Okay, ‘Pioneer One’, holt Anker ein, Anker einholen!“
Der Kapitän der „Pioneer“ bestätigte mit schwerem Akzent: „Roger. Anker einholen.“
An mich gewandt meinte Pandey: „Los geht’s.“ Über Funk wies er das Schiff an, sich von der Küste abzuwenden und Fahrt aufzunehmen. „Kurs eins-sechs-null, volle Kraft voraus. Wie groß ist die Entfernung zum Schiff hinter Ihnen?“
„Sechs Kabellängen.“
„Okay, also, Kurs eins-sechs-null und volle Kraft.“
Die Mastlichter krochen durch die Nacht. Als der Kapitän meldete, das Schiff sei auf auslaufendem Kurs, befahl Pandey, das Ruder hart steuerbord einzuschlagen. Er sagte: „Melden Sie mir Ihren Kurs alle zehn Grad.“
Gleich darauf kam die Antwort: „Eins-sieben-null, ‘Pioneer One’.“ Die Wende war eingeleitet.
„Eins-acht-null, ‘Pioneer One’.“ Da ich die riesige Stahlmasse nicht sehen konnte, mußte ich sie mir vorstellen, wie sie unter Volldampf bebend von der Mannschaft zur Küste gedreht wurde. Der Kapitän meldete die Kursänderungen mit angespannter Stimme. Ich hatte den Eindruck, daß er nie zuvor etwas Ähnliches getan hatte. Doch Pandey gab sich gelassen. Er starrte zu den Silhouetten einiger Schuppen oben am Strand hinüber und nippte an seinem Tee. Aus dem Funksprechgerät drang: „Eins-neun-null … Zwei-null-null … Zwei-eins-null.“
Pandey begann von dem Tauglichkeitstest für Piloten zu erzählen, an dem er vor Jahren teilgenommen hatte. Er sagte: „Diesen Test kann man nur einmal im Leben machen. Entweder man eignet sich als Pilot, oder man eignet sich nicht dazu, und deshalb nimmt man an diesem Test nur einmal im Leben teil. Sehr interessant …“
„Zwei-zwei-null.“
Bei diesem Test hatte Pandey mit mechanischen Steuergriffen einen Punkt in den Grenzen eines sich bewegenden, vier Quadratzentimeter großen Rechtecks gehalten. Mit einem Funkgerät würde er jetzt die „Pioneer“, ein 25 Meter breites Schiff, auf ein knapp 32 Meter breites Strandstück aufsetzen lassen. Es war vermessen, und das wußte er. Ich bewunderte seine Gelassenheit.
Die Schiffslichter kamen näher. Aus dem Funkgerät klang es: „Zwei-drei-null.“
Pandey sagte: „Okay, Kapitän. Sie lassen Ballast ab?“
„Ja, Sir, machen wir. Ballast wird abgelassen.“
„Sehr schön, bitte weiter so.“
Die Zahlen stiegen an. Bei „Drei-eins-null“, die „Pioneer“ schon kurz vor dem Ufer, zeigte Pandey eine erste Regung. Mit lauterer Stimme befahl er: „Okay, halten Sie Drei-zwei-null. Und jetzt, Kapitän! Volle Maschinenkraft!“
Ich trat an den Rand des Wassers. Die „Pioneer“ schälte sich aus der Dunkelheit, ihre Schraube wühlte den Ozean auf, und während sie auf den Strand zuraste, schob sie eine große weiße Bugwelle vor sich her. Ich konnte die Gestalten einiger Männer entdecken, die von Brücke und Bug nach vorn stierten. Dann ertrank der Lärm der Motoren im wasserfallartigen Rauschen der Bugwelle. Ganz in der Nähe stob eine Gruppe Arbeiter auseinander und brachte sich in Sicherheit.
Pandey trat zu mir an den Rand des Wassers. Die „Pioneer“ kam stetig näher. Sie wurde von einer Küstenströmung erfaßt und kurz seitwärts abgetrieben. Dann traf der Kiel auf Grund, und das Schiff prallte hart auf den überfluteten Strand, wurde vom eigenen Gewicht und der vollen Antriebskraft langsam weiter geschoben, bis das Ruder nicht mehr funktionierte, das Heck außer Kontrolle schlingerte und das Schiff keine hundert Schritt von dort, wo wir standen, zum Liegen kam. Anker groß wie ein Auto ratterten herab und platschten ins flache Wasser.
Der Motor erstarb, der Reihe nach wurden die Lichter von vorn nach achtern ausgeschaltet, und schließlich lag die „Pioneer“ reglos in der Dunkelheit.
Wenn, wie behauptet wird, ein Schiff lebendig sein kann, dann war dies der Augenblick, an dem die „Pioneer“ starb. 1971 war sie in Japan gebaut worden und hatte unter diversen Besitzern und wechselnden Namen – „Cosmos Altair“, „Zephyrus“, „Bangkok Navee“ und „Normar Pioneer“ – die Welt umrundet, doch während ich vom Strand aus zusah, wurde sie zum eisernen Leichnam – nach indischem Gesetz und in der Praxis kein Schiff mehr, nur noch eine importierte Stahlmasse. Die Matrosen an Bord ließen den Strahl ihrer Taschenlampe durch die toten Gangways streichen und warteten auf die Ebbe, damit sie eine Strickleiter herablassen und sich trockenen Fußes davonmachen konnten. Die Arbeiter des neuen Besitzers würden am Morgen damit beginnen, den Leichnam zu zerteilen.
(...)