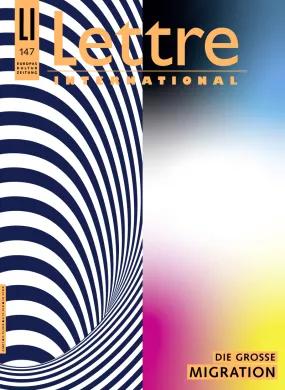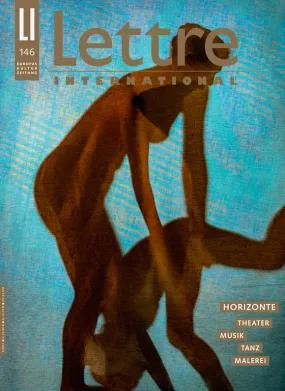LI 68, Frühjahr 2005
Freund oder Feind
Der alte Mann und die Macht - eine Reise ins Carl-Schmitt-LandElementardaten
Textauszug
Vor gut 25 Jahren war ich einmal halb auf dem Weg zu Carl Schmitt. Während eines Aufenthalts im Sauerland, in der Nähe von Plettenberg, überlegte ich, da kein Telefoneintrag zu finden war, ohne Anmeldung nach Pasel zu fahren und Schmitt zu besuchen. Anlaß war neben der Neugier auf die Person die Verwunderung, daß ich in dem mir selber nicht ganz geheuren Zusammenhang eines Kommentars über den (damals politisch linken) Hans Magnus Enzensberger plötzlich die (rechte) Theorie Schmitts anwenden konnte. Aber einen alten Mann – Schmitt war damals knapp neunzig – ohne Anmeldung zu besuchen gehörte sich vielleicht doch nicht. Also ein Brief. Die Antwort kam prompt: „Plettenberg – Pasel 11 c, 22. November 1977. Gut, daß Sie mich nicht ‘überfallen’ haben, denn in diesen Novembertagen geht es mir schlecht. Ein Gespräch mit Ihnen würde mich aber außerordentlich interessieren … Können Sie mir Ihren Enzensberger-Kommentar zugänglich machen? Ich werde mit keiner praktischen Besorgung mehr fertig, nicht einmal mit einer Buchbestellung†… Ich bin Jurist, sogar Berufsjurist, und Hugo Ball hat von mir gesagt (1924!): ‘In der Gewissensform seiner (juristischen) Begabung sieht er seine Zeit.’ Sie selber betonen, daß Sie ‘kein Jurist’ sind. Da steckt ein oft zutage getretenes Hindernis. Bei Klaus Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution (Edition Suhrkamp, Nr. 778, 1976, Seite 396) finden Sie ein Gespräch von 1967 mit mir zitiert und meinen Satz (den heute jeder Knabe empörend und ‘faschistisch’ findet): ‘Ich bin Berufsjurist, kein Berufsrevolutionär.’ Dieses, von meiner Seite aus, als Versuch der Anbahnung eines Gesprächs. Wenn Sie heute in meiner Politischen Romantik die Analyse des bisher einzigen durch einen deutschen Studenten begangenen politischen Mordes lesen (Seite 205 ff.), dann werden Sie meine Resignation verstehen. Alle guten Wünsche Ihres Carl Schmitt.“ Vielleicht war es die Resignation, die aus diesem und einem weiteren Brief sprach, daß ich damals nicht nachgehakt habe. Jedenfalls ist eine persönliche Begegnung nie zustande gekommen. So reise ich gut 25 Jahre später zu einem Toten.
Auf dem Bahnhof von Plettenberg wartet Ernst Hüsmert, „Begleiter“ und Freund Carl Schmitts in vierzig Jahren. Gebürtiger Plettenberger wie Schmitt, gehörte Hüsmert 1947/48 als knapp Zwanzigjähriger zum Freundeskreis von Schmitts Tochter Anima. „Alle Wünsche gehen in Erfüllung; die meisten einige Nummern zu klein, einige wenige aber mehrere Nummern zu groß“, sagte Schmitt damals zu Anima und Ernst Hüsmert. Ein Selbstkommentar? Hüsmert hat nicht nachgefragt, und auch in den folgenden vierzig Jahren fühlte er sich nie als Schmitts Ekkermann. Da Schmitt wußte, daß Hüsmert über ihre Begegnungen und Gespräche kein kontinuierliches Tagebuch führte und ihr Umgang somit frei von verwerterischer Absicht war, entstand eine offene Freundschaft. „Die Sonne Homers leuchtet auch uns. Meinem treubewährten Freund Ernst Hüsmert“, schrieb Schmitt einmal als Widmung in eine kostbare Homer-Ausgabe, die er Hüsmert schenkte. Die Lektüre Homers sei für Schmitt zuletzt wieder wichtig geworden, vor allem durch die Art, wie Homer den heimgekehrten Odysseus dem Schäfer Eumaios seine Lebensgeschichte erzählen läßt, berichtet Hüsmert. Auch Schmitts Leben kann man lesen als aufregende Geschichte einer sonderbaren Heimkehr von einer turbulenten Reise, die manchen als Irrfahrt erschien. Von den Dimensionen und Verstrickungen dieses Lebens werden die Bewohner des Dorfes Pasel allerdings nicht einmal ahnungsweise gewußt und in Schmitt nur den herzlich-liebenswürdigen alten Herrn gesehen haben, der sich jeden Tag pünktlich nach dem Mittagessen auf seine Spazierrunde machte. Wenige Schritte vom Haus „San Casciano“ entfernt überquert man auf einer kleinen Brücke den Fluß Lenne. Schmitts Spaziergang führte durch einen gleich hinter der Brükke beginnenden Wald auf den Schwarzenberg. Der Weg endet auf einem Plateau, mit einer Bank darauf, dem „Engelbertstuhl“, benannt nach dem Grafen Engelbert III., der von hier aus den Blick ins „Land der tausend Berge“ genoß. Die Bank war auch Carl Schmitts Lieblingsplatz. Was mag er gedacht haben, wenn er von diesem Hochsitz auf sein Leben zurückblickte?
Einen Moment lang sehe ich den alten Herrn, korrekt gekleidet, Anzug, Weste, weißes Hemd, Krawatte, auf der Bank auf dem Gipfel des Schwarzenbergs sitzen. Er schaut über die Berge und hinab auf Plettenberg. Gewohnt, auf dem Schwarzenberggipfel allein zu sein, ist er zunächst über den Besuch verwundert, schaut mich mit großen, erwartungsvollen Augen an. „Guten Tag, Herr Professor“, sage ich. „Sie kennen mich?“ fragt der alte Herr erstaunt. „Ich habe Ihnen vor 25 Jahren einen Brief geschrieben.“ „Das ist lange her. Aber es geht ja nichts verloren in der Welt.“ „Ich weiß“, antworte ich: „Abwesende sind zugegen und, was man kaum in Worte fassen kann, Tote sind lebendig.“ „Sie zitieren Cicero. Wunderbar“, sagt der alte Herr und genießt als Lateiner, mir das Original vorzusprechen: „Quocirca et absentes adsunt et, quod difficilius dictu est, mortui vivunt.“ Er horcht einen Moment den Worten nach und fragt nun gar nicht mehr erstaunt: „Warum hatten Sie mir geschrieben, was war das Thema?“ „Das Thema lautete: Kann man in einer unglücklichen Gesellschaft glücklich sein? Kann man auf der falschen Seite das richtige Leben führen? Wie soll man da leben?“ „Oh, die alte Gottfried-Benn-Frage“, freut sich der alte Herr. „Setzen Sie sich zu mir. Ist es nicht schön hier? Der Berg vorne rechts ist der Sundern, daneben sehen Sie den Stadtteil Ohle. Vor über 150 Jahren hat der Freiherr von Vincke, Oberpräsident der preußischen Provinz Westfalen, den Ausblick, den man lenneaufwärts vom Sundern hat, für eine der schönsten Aussichten der Erde erklärt. Heute ist der Blick durch Fabrikanlagen unterbrochen. Sollen wir uns darüber ärgern? Auch der berühmte Blick auf den Golf von Neapel oder der auf die Tajo-Mündung bei Lissabon ist nicht mehr derselbe wie zur Zeit des alten Goethe oder Alexander von Humboldts. Der Kulturfilm zerstört auf seine Weise den Bildungsgenuß, den der Freiherr von Vincke meinte, ebenso gründlich wie die Kleineisenindustrie auf ihre Weise.“ „Aber ist die Veränderbarkeit der Welt nicht auch ihr Zweck“, frage ich, „wobei die Veränderungen natürlich vielen ruinös erscheinen können. Schauen Sie sich um in dieser modernen technisierten Welt der schnellen Zeichen, in einer Zeit der uferlosen Meinungsvielfalt – muß man da nicht noch einmal innehalten, um sich zu vergewissern, ob im Wort, im Ursprung des Wortes, in der Literatur als der letzten Schriftlichkeit des Urerlebnisses der Schöpfung sich etwas bewahren läßt, was in allen elektronischen, digitalisierten Sprachen nicht aufzuheben ist? War das nicht immer auch Ihr geheimes Thema?“ „Natürlich“, antwortet der alte Herr, „aber diese Veränderungen der Welt durch die technische Entwicklung sind kein neues Thema. Ich erinnere mich, daß ich im August 1914 – ich wohnte damals in Düsseldorf – nachts mit dem Zug von Köln zurück nach Hause fuhr und sah, wie am Kölner Dom angebrachte Scheinwerfer den Himmel erleuchteten. Sie fegten wie riesige Kometen über den ganzen Himmel, am Ende war ein dikker Lichtpunkt, der den Eindruck machte, als sei er ein Feuerkörper mit Rüssel, der alles am Himmel in sich aufsaugte wie ein kolossaler Vakuumreiniger. Ein Mensch des 16. oder 17. Jahrhunderts, ein guter Mensch, der zur Natur noch ein Verhältnis hatte, wäre erschreckt und in Ohnmacht gefallen, wenn er dieses unheimliche Schauspiel erlebt hätte. Als wäre man nicht mehr auf der guten alten Erde, die im Frühling grün und im Herbst fahl wird, sondern auf einem phantastischen Stern, auf dem Uranus oder Sirius, so unmenschlich und übermenschlich. Mein Eindruck damals: Der ganze arme, kleine Mensch ist so ad absurdum geführt, daß man von ihm gar nicht mehr reden kann. Aber vielleicht ist auch unsere Technik nur ein Weg, sich mit den Problemen des Lebens abzufinden, vielleicht ist sie selbst philosophisch und der Anfang der größten Philosophie, die je dagewesen ist, und die moderne materialistische, empiristische Philosophie ist nur deshalb so banal, weil sie im Verhältnis zu der greisenhaften Weisheit der bisherigen Philosophie mit der banalen Gesundheit eines Kindes kommt.“ „Schauen Sie“, fährt der alte Herr nach einer Weile fort, „dieses angeblich neue Paradies ist das Paradies einer durchgeplanten Welt, mit allen Herrlichkeiten einer entfesselten Produktivkraft und einer ins Unendliche gesteigerten Konsumkraft, dazu einer großzügig ausgedehnten Freizeit mit entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten. Das Paradies einer technisierten Erde und einer durchorganisierten Menschheit. Die Naturschranke wird fallen, dafür wird uns die Sozialschranke erfassen, und sie erfaßt uns nicht nur, sie verändert uns. Deshalb geht es nicht mehr darum, die Welt und die Menschen zu erkennen, sondern sie zu verändern. Aber Vorsicht: Die künstlichen Paradiese der Technik können sich schnell in echte Höllen verwandeln. Trotzdem werden wir das Ziel der Technik wohl erreichen. Aber was sage ich da: wir? Erinnern Sie sich, daß unsere Urgroßväter und Großväter vor fünfzig, hundert Jahren vorausgesagt haben, daß ‘wir’ fliegen werden. Tatsächlich wird heute geflogen. Aber weder unsere inzwischen verstorbenen Urgroßväter und Großväter noch wir, ihre Enkel, dürfen fliegen. Nicht wir, sondern andere fliegen. Dieses ‘wir’ unserer fortschrittlichen Vorfahren hatte etwas Rührendes. Es beruhte auf einer naiven Identifikation mit den Herren der Welt, denen die technischen Mittel in fünfzig oder hundert Jahren dienen und deren Wünsche die entfesselten Produktivkräfte erfüllen würden. Alle Fortschrittsmythen beruhen auf solchen Identifikationen, das heißt auf der kindlichen Annahme, daß man zu den Göttern des neuen Paradieses gehören werde. In Wirklichkeit aber ist die Auslese sehr streng, und die neuen Eliten pflegen schärfer aufzupassen als die alten.“
Der alte Herr schweigt einen Moment, schaut wieder hinab auf Plettenberg und sagt: „Dort unten in diesem Nest hat alles angefangen. Wenn ich an meinem Geburtshaus vorbeikomme, fallen mir immer zwei Zeilen ein aus Adalbert von Chamissos Gedicht Schloß Boncourt: ‘Dort hinter diesen Fenstern / verträumt ich den ersten Traum.’“ Wie sentimental der alte Herr sein kann, denke ich und sage in sein Schweigen hinein: „Warum kann man nie ganz in der Gegenwart leben? Man spürt sich zwar in der Zeit, doch zugleich ist man mit seinen Erinnerungen in der Kindheit und mit den Phantasien im nächsten Jahrzehnt, so daß man niemals den Platz vollständig ausfüllt, auf dem man gerade lebt.“ „Ja, wie soll man da leben?“ greift der alte Herr den Gedanken auf. „Als ich 1947 ins Sauerland zurückkehrte, habe ich noch einmal in meinen Tagebüchern von 1914 bis 1917 gelesen. Die Lektüre ergab Staunen über die unendliche Unbeweglichkeit des Geschehens, die Unbeweglichkeit dessen, was man Zeit nennt, oder, was dasselbe ist, die unendliche Langmut Gottes. Nichts von sogenannter Entwicklung, nichts Wesentliches von education, nichts von Tempo oder Eile … Sonderbare Gleichförmigkeit, Identität, Wiederholung.“ Wieder ein kurzes Schweigen, dann fährt der alte Herr fort, als rede er zu sich selbst: „Identität unseres Raumes bei Wechsel der Zeit, Gleichbleiben dieses Raumes seit 1907.“ „Dem Jahr Ihres Abiturs“, sage ich. Der alte Herr nickt und fährt nach einer Weile fort: „Es gibt keine wesentlichen Änderungen oder Veränderungen. Das ist alles nur Zeit und der mit ihr verbundene Schein; alles Wesentliche bleibt unveränderlich und unverändert und taucht in periodischen Intervallen immer wieder auf. Entwicklung, Fortschritt, Prozeß, alles nur Zeitillusionen, wechselndes Zeitkostüm (der Gottheit lebendiges Kleid? Der toten Götter dürres Laubgeraschel). Zeit und Meer, Raum und Land liegen fertig da wie die Partitur einer Symphonie, die manchmal aufgeführt wird und dann jahrelang wieder nicht†… Lebenszeit erregt nicht die Unruhe, die Lebensraum erregt. Warum? In Lebenszeit liegt schon der Tod als Grenze. Survivre, sagt auch Mme Su. Ich sehe nichts als Willen zum Überleben. Das also ist der Übermensch: der Überlebenwollende, mehr bleibt nicht übrig. Wen überlebt er? Die Konkurrenten der Lebensbedrohung; die Mitbedrohten oder die Bedroher? Natürlich womöglich beides; eventuell nur die Mitbedrohten. Was überlebt er? Die Lebensbedrohung. Mehr wollen sie nicht: überleben. Alles das Bestätigungen des Bildes, das Hobbes ein für allemal gezeichnet und gemalt hat, um den Ansatz zur Konstruktion der politischen Einheit zu finden; Bestätigung aber auch des bösartigsten Biologismus. Der Weg des Geistes ist der Umweg, sagt Hegel. Abstand, Trennung, Mittelbarkeit, Resultat jedes menschlichen Werkes. Mein Weg von Berlin über Nürnberg nach Plettenberg.“
Ein schöner Tag im Sauerland, und da der alte Herr nun lange schweigt, genieße ich den Blick vom Gipfel des Schwarzenbergs hinab auf die im Tal liegende Stadt Plettenberg, in Carl Schmitts Kindheits- und Jugendjahren tiefste sauerländische Provinz, heute eine prosperierende Mittelstadt mit 30 000 Einwohnern.
(...)