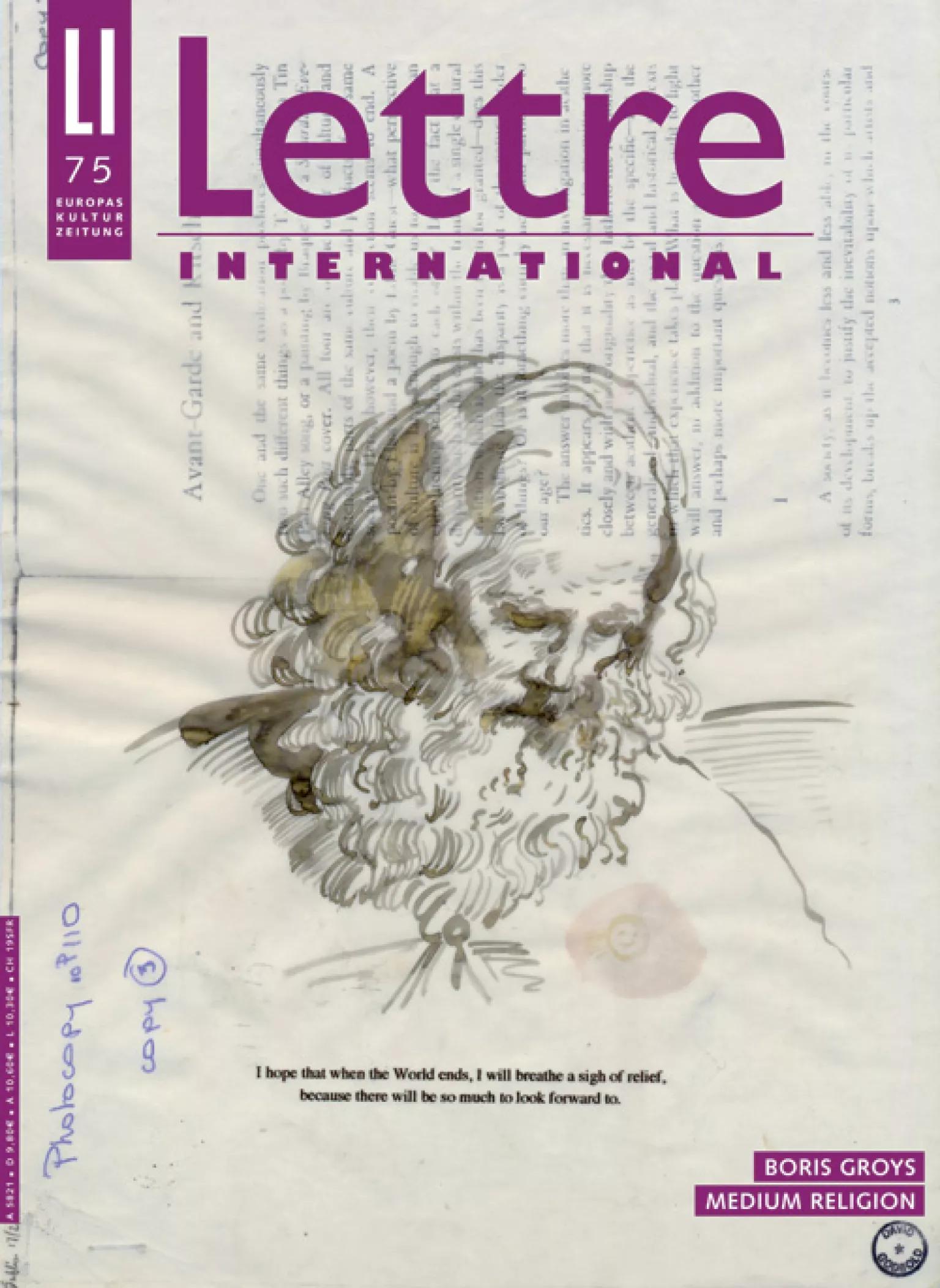LI 75, Winter 2006
Im Niemandsland
Spaziergänge mit Siegfried Kracauer durch Ruinenfelder der ModerneElementardaten
Textauszug
New York, Juni 1960. Siegfried Kracauer hat seine Theorie des Films beendet und vergewissert sich rückblickend in einem Vorwort, welchen wei-ten Weg er zurückgelegt hat von einem der einflußreichsten deutschen Publizisten der Weimarer Republik bis zum englisch schreibenden Autor in Amerika:
"Ich war noch sehr jung, als ich meinen ersten Film sah. Der Eindruck, den er in mir hinterließ, muß berauschend gewesen sein, denn ich beschloß dann und dort, meine Erfahrung zu Papier zu bringen. Wenn ich mich recht erinnere, war dies mein frühestes literarisches Projekt. Ob ich es je ausführte, habe ich vergessen. Aber ich habe nicht seinen umständlichen Titel vergessen, den ich, kaum aus dem Kino zurück, unverzüglich einem Fetzen Papier anvertraute. Der Titel lautete: 'Film als der Entdecker der Schönheit des alltäglichen Lebens'. Was mich so tief bewegte, war eine gewöhnliche Vorstadtstraße, gefüllt mit Lichtern und Schatten, die sie transfigurierten. Einige Bäume standen umher, und im Vordergrund war eine Pfütze, in der sich unsichtbare Hausfassaden und ein Stück Himmel spiegelten. Dann störte eine Brise die Schatten auf, und die Fassaden unter dem Himmel begannen zu schwanken. Die zitternde Oberwelt in der schmutzigen Pfütze – das Bild hat mich niemals verlassen."
Die zitternde Oberwelt, gespiegelt in einer schmutzigen Pfütze – es war die Ruinenlandschaft der Moderne, die Siegfried Kracauer in diesem Bild entdeckte, und er hat sich in dieser Ruinenlandschaft mit einer solchen Verve, Direktheit und aggressiven Expressivität bewegt, daß seine in den zwanziger und beginnenden dreißiger Jahren geschriebenen Texte im Kontext des zwar linksliberalen, aber doch bürgerlichen Feuilletons der Frankfurter Zeitung, deren Redakteur Kracauer war, großes Aufsehen erregten. Die Fremdheit des Blicks, die uns auch heute noch aus seinen Texten entgegenscheint, das kalte Wehen in seinen Sätzen haben schon damals die Leser überrascht und seltsam erregt. Als werde einem die bekannte Welt wie ein wildfremder Ort gespiegelt, an dem alle Dinge nur als chaotische Wucherungen der Sinnlosigkeit erscheinen. Auch aus seiner eigenen Fremdheit und dem Geheimnis seiner Person machte der Autor dabei keinen Hehl und versuchte sogar, um dieses Geheimnis zu bewahren, biographische Spuren zu verwischen. Der Kult um die Bücher Kracauers beruht aber gerade auch auf diesem Geheimnis der Person, das er in seine Texte hineingeschrieben und ebenso außerhalb des Schreibens vehement verteidigt hat. Als Theodor W. Adorno, Freund von Jugend an, 1963 in einem Brief nach New York, wohin Kracauer 1941 auf seiner Flucht vor den Nationalsozialisten über Paris und Lissabon emigriert war, ankündigte, er wolle zu Kracauers 75. Geburtstag ein großes Rundfunkporträt schreiben, freute sich dieser erst einmal in der Erwartung, daß Adorno ihm den Hintergrund seines Werkes, dessen zentraler Bestandteil die bis 1933 erschienenen und Anfang der sechziger Jahre so gut wie vergessenen deutschen Texte waren, zurückgeben wollte; er sei beglückt, dankte er in seiner ersten Antwort Adorno, und das sei beinahe ein Understatement. Doch gleich im nächsten Satz sprach Kracauer die seltsamste Bitte aus, die Adorno sicher jemals vernommen hatte:
"498 Westend Avenue, New York 24, N. Y., October 25, 1963. Lieber Teddy: ... Etwas an Deiner Ankündigung hat mich aber im wörtlichen Sinne tief erschreckt - daß die Sendung aus Anlaß meines 75. Geburtstages erfolgen soll ... Ich bitte Dich inständig darum – and I mean it – bei Deiner Sendung meines Alters mit keinem Wort zu gedenken. Hier handelt es sich bei mir um eine tief eingewurzelte, ganz persönliche Sache. Nenne es eine Idiosynkrasie – aber je älter ich werde, um so mehr sträubt sich alles in mir gegen die Exhibition meines chronologischen Alters. Natürlich weiß ich um die Daten, die immer ominöser werden; doch so lange sie mir nicht öffentlich gegenübertreten, nehmen sie wenigstens nicht den Charakter einer unauslöschlichen Inschrift an, die jeder, mich eingeschlossen, immerfort sehen muß. Zum Glück kann ich die chronologische Fatalität noch ignorieren, und das ist unendlich wichtig für den Fortgang meiner Arbeit, meine ganze innere Ökonomie. Meine Art der Existenz würde buchstäblich aufs Spiel gesetzt, wenn die Daten aufgeschreckt würden und mich von außen her überfielen ... Der Ausdruck Idiosynkrasie ist vielleicht ungenügend, weil er gewöhnlich eine nicht weiter begründbare Aversion physiologischer oder psychologischer Art deckt. In meinem Falle handelt es sich eher um ein alteingewurzeltes Bedürfnis, exterritorial zu leben – sowohl im Hinblick auf das intellektuelle Klima wie auf die chronologische Zeit. Darum liegt mir New York, weil es diese Exterritorialität ermöglicht; darum suche ich der chronologischen Etikettierung zu entgehen. Es ist nicht, als ob mir etwas daran läge, jung oder jünger zu erscheinen; es ist einzig die Scheu davor, durch die Fixierung des Datums und die unvermeidlichen connotations einer solchen Fixierung der chronologischen Anonymität entrissen zu werden."
Steckte hinter der Bitte, Adorno möge sein Geburtsjahr verschweigen, nur eine persönliche Marotte? Natürlich konnte schon 1963 jeder, der Kracauers private Daten kennenlernen wollte, sie auch in Erfahrung bringen. Geboren 1889 in Frankfurt als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie – ein Onkel war Historiograph der Frankfurter Juden. Der junge Siegfried Kracauer mochte sich nicht. Allein dieser als schrecklich empfundene Vorname. 1911 skizzierte er in seinem Tagebuch ein "Märchen", in dem die Hauptperson „nicht mehr als eine Einzelnatur blühen und vergehen will, ihren Namen ablegt und sich unter die Menschen begibt, mit der unersättlichen Sehnsucht, das eigene Ich hinauszuschleudern in die Welt! Wohin? Gleichviel!" Sieben Jahre später, 1918, bestätigte er sich: "Daß ein Mensch sagen kann: ich beurteile mich, ist das ungeheuerste Rätsel. Wer ist das eine Ich, wer das andre?"
Privat nannte Kracauer sich mit Vornamen Friedel und wurde so auch von Freunden genannt. Aber auch als Friedel Kracauer fühlte er sich eingesperrt: "Es will mir nicht in den Kopf hinein, daß ich ein abgeschlossenes, begrenztes Leben führen soll, daß es einmal heißen wird: So und so war und lebte Friedel Kracauer. Alles, was es gibt, müßte in meinem Leben miteinbegriffen sein ..." Ab Mitte der zwanziger Jahre war Kracauer auch der Vorname Friedel nicht mehr genehm, und als Ernst Bloch ihm das Du anbot, geriet er in enorme Schwierigkeiten: "Mein lieber Freund Ernst, ich bin sehr glücklich, daß Sie mir Ihren Vornamen anvertrauen. Schon längst hätte ich Ihnen gerne den meinen übergeben, aber ich besitze keinen mehr. Der offizielle 'Siegfried' scheidet von vornherein aus und der private ‚Friedel' ist von früher her ... mit einer Reihe so unangenehmer Assoziationen belastet, daß ich mich nicht unter ihm fassen kann. Die Menschen, die ihn noch gebrauchen, ragen aus der Vergangenheit mehr oder weniger in die Gegenwart herein, meine Frau Lili hat zu Friedel nie eine Beziehung gehabt, sondern für ihn einen Katalog von Namen erfunden, die freilich patentrechtlich geschützt sind. Bitte, sagen Sie Krac zu mir. Es ist das der Eigenname, den die paar mir heute nahe stehenden Menschen verwenden, ich fühle mich bei ihm wohl und möchte mich gerne von Ihnen so genannt hören. Übrigens habe ich in meiner Pedanterie den Helden des Romans Ginster aus der Abneigung gegen meinen Vornamen heraus auf die Formel Ginster gebracht."
Ginster. Von ihm selbst geschrieben - unter diesem Titel hatte Kracauer den Roman 1928 als anonyme Autobiographie erscheinen lassen. Der einsame, verschlossene und in sich versteckte Ginster – ein Name, "der ihm aus der Schule geblieben war" – war natürlich Siegfried Kracauer selbst. Als Junge litt er darunter, daß er wegen seiner körperlichen Kleinheit und Schmächtigkeit in der Schule immer auf der vordersten Bank sitzen mußte. Und dann war da seine Häßlichkeit. Tagebuch, 22. Februar 1903: "Es tut mir ja so schrecklich leid, daß ich nicht schön bin." Vier Jahre später notiert er im Tagebuch einen Besuch bei dem Freund Max Flesch: "Den Abend vergesse ich nicht. Ich kam mit hochstrebenden Gefühlen, hatte mir bestimmte Vorstellungen von Max gebildet und dachte, ihn vieles bitten zu können. Auf der Treppe, wer trat mir da entgegen? Ein Mensch, bildschön, und viel, viel größer wie ich. So schön und einen niedlichen und doch entwickelten Gesichtsausdruck! Er ist ein richtiger, wollender Mensch geworden. Einer der Reichtum zu schätzen, gesellschaftliche Reize zu genießen versteht und sich doch ein Gemüt bewahrt hat. Er sprach von seinem vergnügten Winter, Bummeln, Bällen, Flammen; ich sah ihn an und sagte nichts; er muß mich für sehr langweilig halten. Die Erna Pinner ist augenblicklich seine Flamme. Es muß schön sein, von einem solchen Menschen geliebt zu werden. Und er weiß, was er will. O ja! Ich kam mir klein neben ihm vor, winzig klein ... Seine Freiheit ist tausendmal schöner und besser wie meine! Er wird von einem Mädchen geliebt und schwärmt für sie. Ich wollte, ich fände auch ein Mädchen, das ich lieben könnte, und das mich ... ansähe."
Als „negroid" wurde Kracauers Erscheinung empfunden. Ein damaliger Bekannter, Richard Plant, später Literaturwissenschaftler in Amerika und mit Kracauer bis zu dessen Tod befreundet, hat erlebt, wie der junge Kracauer aus Einsicht in seine Fremdheit die Welt und andere Menschen von sich fernhielt: "Kracauer hat es den Menschen nicht leichtgemacht, ihm nahezukommen, ... auch durch sein physisches Aussehen, er sah ja aus, als trage er eine Maske aus Peru. Es war kein europäisches Gesicht. Ich fand das faszinierend als junger Mensch, exotisch, aufregend, endlich sah mal jemand anders aus, aber viele Leute haben sich daran gestoßen."
Kracauer versuchte seine Häßlichkeit zu verstecken, indem er sich bewußt mythische Züge verlieh. Sein Gesicht, erinnerten sich Freunde, nahm dann "exterritorial wie aus dem Fernen Osten" etwas Steinernes an. Doch da gab es auch eine innere Lebensverhinderung, die nicht zu verstecken war, weil sie nach außen durch einen hemmenden Sprachfehler drang. Tagebuch, 9. Februar 1903: "O Gott, hilf mir doch und gib mir die Kraft, meinen Fehler zu überwinden. Denn wenn ich nicht mehr stottere, dann fühle ich die Kraft in mir, es zu etwas zu bringen. Und laß mich auch zu einem guten Menschen werden, der seine Pflicht tut und offen ist, den seine Mitmenschen lieben." 5. Juni 1911: "Trübe Zeiten! In manchen Stunden ersehne ich mir den Tod; der Gedanke an ihn ist mir der süßeste Trost. Nichts lebt von Hoffnung in mir, der Alltag hat mich ganz klein und mürbe gemacht. Und diese Müdigkeit, die aus dem Körper aufsteigt. Und diese grenzenlose Einsamkeit! Nicht wissen, ob man der Liebe überhaupt fähig ist! Was ist nur in mir, was mich fremd, treulos und fühllos und einsam macht? Und unzufrieden mit mir? Wohin steure ich? Was ist mein Weg? Früher konnte ich leicht weinen; als Kind vergrub ich mich ins Kopfkissen und weinte heiße Tränen. Wenn mich die Eltern nach dem Grund fragten, so wußte ich keinen anzugeben. Dann sagten sie, es sei Nervosität. Aber es war immer die Einsamkeit und ein Bedürfnis nach Liebe, das sich mit keinem Gegenstand, keinem Menschen zufrieden gab. Heute darf ich nicht mehr weinen! Nur noch eines gibt es für mich: Jede Bitternis, jedes Ressentiment überwinden! Von sich wegsehen lernen! Seine Tiefen ignorieren, verachten. Am härtesten gegen sich selber sein!"
(...)