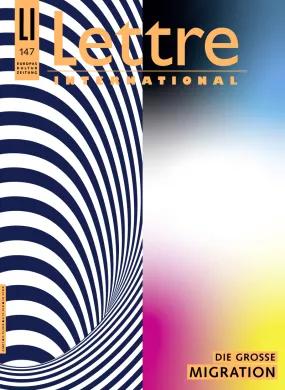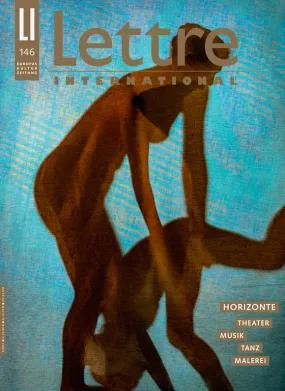LI 108, Frühjahr 2015
Das Grab der Illusionen
Erinnerungen an eine Reise durch die Wüste zum gelobten Land EuropaElementardaten
Genre: Erzählung
Übersetzung: Aus dem Französischen von Angelica Ammar
Textauszug: 8.572 von 58.887 Zeichen
Textauszug
„Die Vorstellung entsteht nicht aus dem Nichts; sie nährt sich von dem, was wir leben.“
Kaum hatte ich mich von meiner Familie verabschiedet, geriet ich in die Wirren des Abenteuers. Des Traums, den jeder junge Mann aus meinem Umfeld hegt. Der Exodus, von außen wie eine Plage gesehen, eine Folge der Armut, ist ein ganz normaler Prozeß der Initiation, die jeder junge Mann durchschreiten muß, um sich das Recht zu erwerben, das Wort zu ergreifen, eine Frau zu nehmen. Ich war kurz nach der Ernte aufgebrochen, in der Hoffnung, bei meiner Rückkehr reich zu sein und mir die Achtung der Meinen zu erwerben.
Meine Reise begann mit einem ungewollten dreitägigen Aufenthalt am Busbahnhof von Agadez, inmitten von Fremden. Sie waren alle vollkommen unterschiedlich, und jeder stand dem Traum des anderen im Weg. Alle redeten von einer besseren Welt, in der sie Frauen, Villen und Autos hätten und das Geld mit vollen Händen ausgeben könnten. Mein Vater hatte immer gesagt, für Geld sei ein Mensch zu allem fähig, sogar, seinen Nächsten zu töten. In Agadez zweifelte ich bald nicht mehr daran. Man hatte mich vorher gewarnt, daß es am Busbahnhof von Betrügern wimmelt, die Leute wie mich übers Ohr hauen. Ich hatte Angst. Um die Schulter trug ich mein Bündel, in einer kleinen Seitentasche, von der ich nie die Hand nahm, steckte meine Geldbörse.
(...)
Und so machten wir uns auf den Weg, etwas desorientiert, aber entschlossen. Wir mußten zum Busbahnhof zurück und wieder bei Null anfangen, einen neuen Fahrer finden.
Drei Tage lang brachten wir dort zu, während der die Ruhe ohne Ende von den verzweifelten Schreien Reisender unterbrochen wurde, die Opfer eines Diebstahls geworden waren. Immer wieder sah man Leute hinter einem unerfahrenen Dieb herlaufen, um einen anderen Reisenden herumstehen, den man beim Durchwühlen eines fremden Gepäckstücks ertappt hatte. Diebe wie Gepäckschnüffler endeten in einem kleinen Verschlag, vor dem zwei abgehalfterte Polizisten thronten und ihre Altersvorsorge aufbesserten. Ein oder zwei Münzen verhalfen diesen Amateurdieben wieder zur Freiheit. Erst das Rad des Schicksals würde ihrem Tun einmal ein Ende bereiten. Wenn sie Pech hatten, würden sie ihr Blut dabei vergießen oder im Gefängnis landen. Andere mochten sich in die Religion flüchten und ihre verbissensten Verfechter werden.
(...)
Sandmeer
Am dritten Tag gegen vier Uhr nachmittags, nachdem sich alle in einem hastigen Gebet Gott empfohlen hatten, ging ein Mann die kleinen Gruppen ab und kündigte die Abfahrt an. Er deutete auf einen Lastwagen in einer Ecke des Busbahnhofs, auf dem noch die Insignien der Armee zu sehen waren. Eine Bande Herumlungernder beobachtete uns und unterhielt sich dabei fluchend. Alle Reisenden versammelten sich um den Lastwagen. Jeder wollte als Erster einsteigen, um einen halben Sitzplatz zu ergattern. Wir standen schweigend in einer Reihe wie zum Tode Verurteilte und warteten, daß unsere Namen aufgerufen würden. Ein Mann mit einem Turban um Kopf und Gesicht, bei dem man sich fragte, was er wohl zu verbergen hatte, las die Liste vor. Alle waren dabei. Die Meute stürmte den Lastwagen. Von Sitzplätzen konnte keine Rede sein, man hatte Glück, wenn man etwas zum Festhalten hatte. Wer schnell genug gewesen war, saß auf der Ladefläche, die anderen drängten sich auf dem Dach des uralten Lastwagens, der ächzte wie ein Tuberkulosekranker im Endstadium. Ich fragte mich ernsthaft, ob ich nicht lieber umkehren und meinem Vater helfen sollte, sein karges Stück Land zu bewirtschaften. Aber etwas hinderte mich daran, auf mein Herz zu hören. Meine Mutter würde es mir nie verzeihen, einen Sohn in die Welt gesetzt zu haben, der unfähig war, sie von der Süße des Abenteuers kosten zu lassen wie die anderen jungen Männer der Region. Eingequetscht zwischen zahllose andere Passagiere, die wie die Sardinen aneinander gedrängt waren, übte ich mich in Geduld. Immer noch mehr Reisende stiegen ein. Wir beschwerten uns. Ein Mann setzte entgegen: „In der Wüste ist ein Wagen niemals voll.“
(...)
Von hier an waren wir auf arabische Führer angewiesen. Für viel Geld schmuggelten diese Reisende über die Grenze nach Libyen. Wir mußten diskret auf ihre Suche gehen und mit ihnen verhandeln. Wir ruhten gerade unter einem Baum aus, als ein Mann kam und erklärte, dieser Baum gehöre ihm. Sein Großvater habe ihn gepflanzt, sein Vater habe ihn geerbt. Jetzt sei er in seinem Besitz. Wer den Tag unter ihm verbringen wolle, müsse 500 Franc bezahlen, eine kürzere Rast koste 200 Franc. Rasch suchten wir das Weite, wir hatten nicht das Geld, um uns diesen Luxus zu erlauben. Von jetzt an blieben wir am Dorfrand, die Bäume meidend, und hofften, möglichst bald einen Führer zu finden und Dirkou verlassen zu können. Nach einer Weile wurden Oussou und ich uns mit einem Araber einig, der bereits elf Ghanaer akzeptiert hatte.
Um Mitternacht brachen wir auf. Vier Stunden lang fuhren wir über die Dünen und durch Palmenhaine. Gegen acht Uhr morgens erreichten wir eine weitere Garnison, Dao Timi. Ich hörte, daß hier früher politische Häftlinge gefangen gehalten worden waren. Wir hielten in einiger Entfernung an, da fremden Fahrzeugen die Zufahrt nicht gestattet war. Wir verbrachten den Tag unweit der Garnison.
Bei Einbruch der Nacht nahmen wir die Fahrt wieder auf. Es war eine Schotterpiste voller Schlaglöcher, auf der wir so durchgerüttelt wurden, daß uns Hören und Sehen verging. Um zehn Uhr kamen wir an den Grenzposten von Madama. Ich war zutiefst enttäuscht über die Grenzbeamten. Vollkommen gleichgültig ließen sie uns wie Tiere stundenlang in der brennenden Sonne stehen.
Nach einer Weile verlor ich die Geduld angesichts der verächtlichen Haltung unserer Brüder. Wie soll je eine Union der afrikanischen Staaten entstehen, wenn die Menschen sich so verhalten, sobald sie auch nur ein bißchen Macht ausüben können? Es bedrückte mich zu sehen, wie meine Kameraden aus Ghana und der Elfenbeinküste behandelt wurden, die schließlich ebenfalls vor allem Afrikaner sind.
Jetzt begriff ich, warum wir so leicht kolonisiert werden konnten. Noch vor einer Union zwischen den Ländern muß es eine Brüderlichkeit zwischen uns Afrikanern geben, was nicht funktionieren wird, solange die Sicherheitskräfte feindselig gegen jeden „Fremden“ vorgehen, der eine Grenze passieren will. Nach mehreren Stunden erniedrigenden Wartens konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Entschlossen ging ich zu den Grenzbeamten und begrüßte sie. Einer von ihnen rief mir zu:
„Na! Ihr wollt also endlich weiterfahren!“
„Brüder, ihr müßt unsere Situation verstehen. Wir haben eine lange Reise vor uns. Seit Tagen leiden wir unter Sonne, Durst, Hunger und Müdigkeit. Es ist eure Pflicht, euch unser anzunehmen, damit wir unseren Weg fortsetzen können“, bat ich.
„Er macht sich über uns lustig“, gab einer von sich, der auf einer Liege ausgestreckt war.
Mir wurde klar, daß Abenteuer viel Geduld erfordern. Was bewegte diese Leute dazu, uns so zu behandeln? Hatten sie vergessen, daß wir auf derselben Erde leben, dieselben Bräuche und sogar dieselbe Religion haben? Sie müßten uns doch verstehen, uns unterstützen und zeigen, daß wir hier bei uns in Afrika sind. Aber nein, Korruption und Habgier hatten sie dermaßen geblendet, daß sie den Sinn für Menschlichkeit verloren hatten.
„Ihr verliert eure Zeit“, sagte unser arabischer Führer. „Die kennen nur die Sprache des Geldes. Es hilft nichts, das sind tausend Franc für jeden.“
Ohne weiter zu diskutieren händigten mir alle den Betrag aus. Die Grenzposten empfingen mich freudig, als sie mich mit den elf Scheinen in der Hand kommen sahen. Sie nahmen das Geld in Empfang und wünschten uns gute Reise, ohne unser Gepäck zu kontrollieren.
Wir setzten unsere Reise fort, froh, eine Region zu verlassen, in der derartige Ungerechtigkeit und Misere herrschen.
Wir fuhren bereits mehrere Stunden auf libyschem Gebiet, als vor uns ein Fahrzeug auftauchte. Beide Fahrer hielten an und tauschten sich auf Arabisch aus. Wir liefen zu den Passagieren des anderen Wagens, alles Reisende auf dem Weg zurück in ihr Land. Es waren 15, darunter eine Frau. Sie erzählten uns, daß sie von Banditen überfallen worden seien. „Bevor sie uns ausraubten, mußten wir uns alle nackt ausziehen. Als einer unserer Kameraden bat, seine Frau davon zu verschonen, haben sie ihn verprügelt und seine Frau vergewaltigt“, erzählte einer der Passagiere. „Dann haben sie uns gezwungen, das gleiche Verbrechen zu begehen. Jedem haben sie zwanzig Peitschenschläge versetzt, dann sind sie mit unseren gesamten Habseligkeiten verschwunden.“
(...)