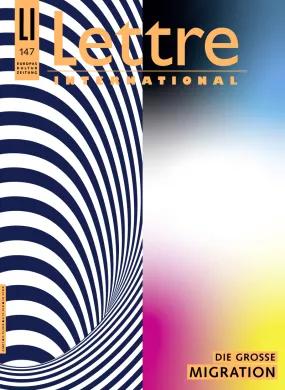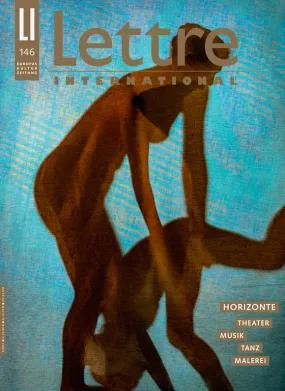LI 67, Winter 2004
Endstation Bombay
Vom Dorfjungen zum Taxifahrer - ein Ausreißer erzählt sein LebenElementardaten
Genre: Chronik, Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Englischen von Martin Pfeiffer
Textauszug
Ich bin auf der Suche nach einem Fahrer, seit sich der letzte mit dem Vorschuß, den ich ihm törichterweise gegeben hatte, aus dem Staub gemacht hat. Mir fällt ein Taxifahrer auf, der jeden Morgen um sieben Uhr im Hof des Dariya Mahal, wo ich wohne, mit seinem Wagen wartet. Sein Taxi riecht immer sauber, vor dem Schrein über dem Armaturenbrett sind frisch angezündete Räucherkerzen befestigt, der Fahrer ist stets höflich, und auf der Stirn trägt er ein Zeichen aus Sandelholzpaste von der puja, die er am Morgen verrichtet hat.
Eines frühen Morgens, als ich das Dariya Mahal verlasse und mich nach Bandra in mein Büro begeben will, sehe ich sein Taxi draußen stehen und komme mit ihm ins Gespräch. Er heißt Ramesh, und als er erfährt, daß ich ein Buch schreibe, sagt er: „Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Wenn ich es könnte, würde ich so eine Geschichte für Sie schreiben.“ Er kennt alle Gäßchen der Stadt, er weiß, wo das Verbrechen wohnt. Er hat gesehen, wie die Leute vor einem Zusammenstoß mit der Polizei flüchteten, hat gesehen, wie vier Männer einen Rikschafahrer aus seinem Gefährt zerrten und ihn erstachen. Er kennt das Bordell gegenüber vom Simla House, und er weiß von einem anderen in den Ashoka-Apartments nahe Petit Hall, wo man gutaussehende Mädchen aus dem Dorf hinbringt und sie herausfüttert, bis sie hübsch aussehen, und sie dann für bis zu 50 000 Rupien pro Nacht verkauft. „Ich kann nicht schreiben, sonst könnte ich Ihnen so eine Geschichte schreiben.“ Fünf Rupien für Kaffee haben sein Schicksal besiegelt.
Als das Taxi am Grab des Haji Ali vorbeifährt, berührt er seine Augen und küßt seine Finger „für Haji Ali Baba“. In seinem Dorf wohnt kein einziger Muslim – sie haben ein eigenes Dorf ganz für sich – , aber Ramesh sagt: „Ich glaube an Allah und auch an Bhagwan. Das ist dasselbe.“
Er will, daß ich ihn einstelle, aber nicht als Fahrer. „Wird es in Ihrem Buch Bilder geben? Ich werde Aufnahmen machen. Sie können mir eine Kamera geben, und immer, wenn ich auf eine Szene stoße, werde ich für Sie ein Bild davon machen. Ich fahre den ganzen Tag Taxi, und ich sehe dauernd Szenen, erstaunliche Szenen. Die Leute werden nichts dagegen haben, wenn ich eine Aufnahme mache, weil ich Taxi fahre.“ Er will Photos von Unfällen machen, von Messerstechereien, von Menschenansammlungen. Ich bitte ihn, in mein Büro zu kommen, damit wir uns darüber unterhalten können. So taucht er eines Sonntagvormittags in Bandra auf, und ich mache Tee für ihn. Wenn ich in Bombay aufgewachsen und dort geblieben wäre, hätte ich das nicht fertiggebracht – für einen Fahrer Tee zu kochen und ihm zu servieren und ihm den Zucker umzurühren; aber ich war im Ausland gewesen und hatte das Kastengefühl verloren.
Wir reden den ganzen Tag; um die Mittagszeit gebe ich ihm Geld, damit er sich im Lucky-Restaurant biryani bestellen kann. Ich möchte zu Mittag essen und meine E-Mails durchsehen, und ich rechne damit, daß er ein oder zwei Stunden fort sein wird. Doch er kommt schon nach einer halben Stunde wieder und ist begierig, seine Lebensgeschichte weiterzuerzählen. Er ist etwa um die gleiche Zeit wie ich im Dariya Mahal herangewachsen, aber er hat in den Garagen, in den Dienstbotenquartieren gelebt. Als er von den markanten Punkten seiner Kindheit spricht – von der Schule, dem Meer, dem Garten, den Tiefgaragen –, wird mir klar, daß es dieselben sind wie bei mir, und er kann mir zusätzliche Details über die andere Welt liefern, die der Dienstboten, der Fahrer und Köche, die unseren Raum gemeinsam mit uns bewohnten, ohne daß sie unser Leben kreuzten. Wenn sie es taten, war das Ergebnis gewöhnlich katastrophal, für uns und für sie.
Er erzählt seine Geschichte gut, ohne sich in Details zu verlieren oder sie übermäßig auszuschmücken, er beugt sich etwas vor und möchte zum nächsten Punkt in der Handlung seines stürmischen Lebens kommen. Ich kann das, was er sagt, fast genau so niederschreiben und wiedergeben, wie er es mir erzählt, ohne daß ich etwas für ihn interpretieren oder erklären müßte. Es ist eine Chronik flüchtigen Lebens in der Metropole, des ständigen Hin und Her zwischen dem Dorf und der Stadt und dem Ausland; und die Geschichte eines Lebens, das immer von Gewalt bedroht ist.
Ramesh Gowda ist „32 oder 33, ich weiß nicht genau“. Er stammt aus dem Dorf Kundur, das etwa vierzig Kilometer von Mysore im Bundesstaat Karnataka entfernt liegt. Das Dorf umfaßt 500 Haushalte, und von jeder Familie sind mindestens zwei Mitglieder in Bombay beschäftigt. Sie arbeiten als Hausangestellte, in kleinen Restaurants, als Gärtner, in Fabriken, als Fahrer und Autowäscher. Die meisten von ihnen leben in Chembur, in der Nähe von riesigen Chemiefabriken. Rameshs Familie wohnte jedoch in einer gehobeneren Gegend: an der Nepean Sea Road. Sein Vater arbeitete in der Walsingham School – die meine Schwestern beide besucht haben – und kam jedes Jahr oder alle zwei Jahre für einen Monat ins Dorf zurück und brachte aus Bombay Kekse, Seife, Kleidung und seine schlechte Laune mit. In Bombay hatte sein Leben einen gewissen Stil, und es verdroß ihn, daß er seiner Familie Geld schicken mußte. Nach dem Tod von Rameshs Großvater kehrte der Vater auf Dauer zurück und schikanierte seine Familie; er konnte keine Arbeit finden, konnte im Dorf nicht gut leben.
Ramesh wuchs heran und haßte die Schule und liebte Bäume. Einmal kletterte er auf einen Tamarindenbaum, und der Lehrer erwischte ihn und schlug ihn mit einem Stock. Er schlug mit einer Schiefertafel zurück und rannte weg. Als sein Vater davon erfuhr, „schlug er mich heftig“. Um der Schule zu entgehen, lief der Junge in die Felder und verbrachte die Tage dort. Nach einigen Tagen fand sein Vater das heraus, „und er schlug mich wieder heftig“. Erneut versteckte er sich acht Tage lang, hinter dem Haus. Er hielt sich verborgen, bis die Schule aus war, und schloß sich dann den anderen Jungen an. Diesmal hob ihn sein Vater, als er das herausfand, an den Händen hoch und schleuderte ihn auf den Boden. Dann schlug er ihn mit einem Stock auf den Kopf.
Heute, zwanzig Jahre später, zeigt mir Ramesh die Narbe an der Schläfe, die er von den Schlägen zurückbehalten hat. „Er sagte, ich soll sterben.“ Seine Mutter und seine Schwester glaubten, er werde den Jungen umbringen, und sie jammerten. Danach nahm man ihn aus der Schule und schickte ihn in die Berge in der Umgebung des Dorfes, wo er Kühe und Ziegen hüten sollte. Die Erzählungen von seinen Hirtentagen klingen wie die Geschichten von Krishna in Mathura. „Ich brachte sie um neun Uhr morgens hin und um halb sechs wieder zurück. Acht bis zehn von uns gingen hinauf in den Wald. Den ganzen Tag spielten wir uns gegenseitig Streiche. Der eine ließ das Vieh des anderen in die Zuckerrohrfelder, wo es das Zuckerrohr fraß, so daß der Bauer die Kuh irgendwo festband. Ich kletterte auf ihre Kokospalmen und trank die Kokosnüsse aus. Sie beklagten sich bei meinem Vater.“
Eines Tages trieb er die Büffel in einen Fluß und forderte einen anderen Jungen auf, ins Wasser zu kommen; er würde ihm Schwimmen beibringen. Der Junge kam ins Wasser und war nahe daran zu ertrinken. Ramesh rief ihm zu, er solle sich am Schwanz eines Büffels festhalten; dann schlug Ramesh den Büffel, und das Tier zog den Jungen aus dem Wasser. Doch die anderen Jungen erzählten Rameshs Vater, daß sein Sohn fast den Tod seines Kameraden verursacht hätte. Da entschloß sich sein Vater, ihn nach Bombay zu schicken. Im Dorf hatte er ohnehin keine nennenswerte Zukunft. In jenem Jahr hatte das Dorf nichts zu essen. Die Ernte war mißraten, und es gab keine Arbeit. Die Dorfbewohner gingen dazu über, ans Flußufer zu gehen und ein bestimmtes Gras zu pflücken, das sie dann kochten und aßen.
Ramesh war eines von sieben Kindern; fünf Brüder und zwei Schwestern waren sie. Einer seiner Brüder arbeitete als Hausangestellter in Sagar Kunj hinter dem Dariya Mahal. Sein Vater schrieb ihm, er solle Geld für Rameshs Bahnfahrt schicken. Das tat er nicht, und sein Vater beschloß, für seine Fahrkarte zehn Ziegen zu verkaufen. Sie brachten die Ziegen zehn Kilometer weit in die Marktstadt, aber keine der Ziegen wurde verkauft. Der Vater tobte; er sagte, Ramesh bringe ihm Unglück, und schlug ihn die ganze Zeit auf dem Rückweg ins Dorf. „Zu Hause schlug mich mein Vater wieder, und meine Mutter weinte und sagte, er werde mich umbringen.“
Seine Mutter wandte sich an ihren Neffen, der aus Bombay gekommen war. Der Neffe versprach, Ramesh dorthin mitzunehmen. Ramesh war sehr glücklich, daß er nach Bombay fahren sollte; er erzählte allen davon. Er starrte immer die Männer an, die aus der Stadt zurückkamen: „Sie waren gesund, nicht so dünn wie die Leute aus dem Dorf. Sie trugen chappals; ich starrte ihre chappals an, denn wir trugen keine. Sie trugen Hosen und Schuhe.“ Das Dorf existierte in einer Art Zeitlosigkeit. Ramesh war noch nie im Kino gewesen, er wußte nicht, was ein Film ist. Wenn ein Motorrad durch den Ort fuhr, rannte er zwei Kilometer weit hinterher, voller Staunen.
Als Ramesh zehn Jahre alt war, wurde er mit seinem Onkel und seinem Vetter nach Bombay geschickt. Eines Montagmorgens standen sie um vier Uhr auf. Seine Mutter packte ihm Kleidung ein und etwas zu essen: Joghurtreis, in supari-Blätter gewikkelt, und wadas. Sie hatte ihm eingeschärft: „Wenn du im Zug bist, streck die Hände nicht aus dem Fenster.“ Die drei Kilometer in die Stadt gingen sie zu Fuß – Busse gab es nicht. Dann nahmen sie einen Lastwagen, der sie nach Arsikere zum Zug brachte. Ramesh ärgerte seinen Vetter mit dem, was er im Zug anstellte – er ließ das Wasser aus den Hähnen laufen, knipste das Licht ein und aus und starrte die Verkäufer auf dem Bahnsteig an. In Miraj stiegen sie in den Mahalaxmi-Expreß um und fuhren nach Bombay bis zum Bahnhof Dadar; von dort nahmen sie ein Taxi nach Chembur.
Unterwegs machte er aus Versehen die Tür des Taxis auf, und sein Vetter schlug ihn. Sie kamen zu dem Slum seines Onkels, der in einer Fabrik arbeitete. Draußen sah Ramesh ein Fahrrad; er setzte sich darauf, um ein Stück damit zu fahren, und stieß mit einigen Frauen zusammen, die Wasser holten; dabei zerbrachen ihre Krüge. Sie schimpften ihn aus, und er brachte das Fahrrad zurück und ließ es vor dem Haus seines Onkels stehen. Kurz darauf war es nicht mehr da: Die Frauen, deren Krüge zu Bruch gegangen waren, hatten es konfisziert. Der Onkel warf ihn hinaus und schickte ihn zu einem anderen Onkel in Santacruz, der ihn bei einer Gujarati-Familie als Hausdiener unterbrachte. Dort gab man ihm leckere Sachen zu essen: chapatis mit ghi, süßem dal und feinem Reis. „Das gefiel mir. Ich sah mir den Fernseher an und sah Leute darin und wunderte mich, wie die Leute da hineingekommen waren. Mir wurde gesagt, sie kämen da durch den Strom hinein, aber ich wußte nicht, was Strom ist, denn in unserem Dorf gab es keine Elektrizität.“
Eines Tages gab ihm sein Arbeitgeber fünf Rupien und wies ihn an, auf den Markt zu gehen und Kaffee zu kaufen. Als er am Bahnhof vorbeiging, sah er den Nahverkehrszug einfahren. „Ich blieb stehen und starrte ihn an. Ich fand das seltsam – dieser riesengroße Zug.“ Er stand in der Nähe des Imbisses und sah, wie Leute Erfrischungsgetränke tranken. Vom Durst und von den verlockenden Limonaden angezogen, gab er dem Verkäufer im Imbiß die fünf Rupien, und der gab Ramesh eine Flasche Fanta und das Wechselgeld. „Ich dachte, mit fünf Rupien könnte ich die Welt kaufen.“ Dann fuhr ein Zug in den Bahnhof ein. Der Junge stieg zusammen mit allen anderen Leuten ein. Der Zug hielt in Dadar, und er stieg aus. Er lief auf dem Bahnhof umher. Inzwischen war es drei Uhr nachmittags, und plötzlich fiel ihm der Kaffee ein, und er bekam Angst. Er hatte eine Rupie und vierzig Paisas ausgegeben; er traute sich nicht, vor seinen Arbeitgeber zu treten. Ramesh dachte, er sollte zurück in sein Dorf laufen. „Es hielt ein anderer Zug, und ich stieg ein.“
(...)