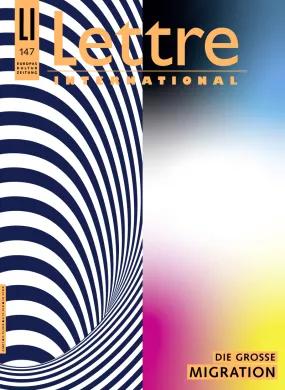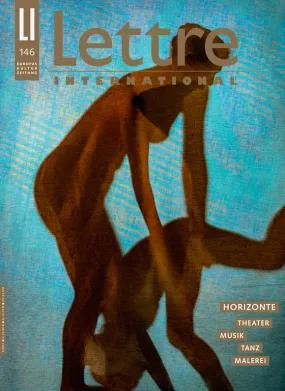LI 86, Herbst 2009
Im Grunewald
Elementardaten
Genre: Erinnerung, Literarische Reportage / New Journalism
Übersetzung: Aus dem Ungarischen von Eva Zador
Textauszug
Ich spaziere mit dem Urgroßvater meines Urgroßvaters durch den Berliner Grunewald. Er hält mich an der Hand, zieht mich hinter sich her, seine Füße sind riesig, und sein Bart ist furchtbar lang. „Es blühen die Linden“, sagt er, „Segen sinkt nun auf den Wald herab, brocho me-haschomajim.“ Wir schnuppern in den Sonnenschein, er zeigt mir, wie er hineinschnuppert, während er flüsternd wiederholt: „Segen, Segen“. Der Duft der Linden dringt in mich ein, liegt mir im Magen, pulsiert in meinen Genen, und ich weiß, daß sich auch die Urenkel meiner Urenkel erinnern werden. „Jetzt sind die Tage lang, das macht das Beten kompliziert“, sagt er. „Ein wenig kompliziert … Weil das morgendliche Schma eigentlich noch vor dem Sonnenaufgang und das abendliche nach dem Sulhán Áruch nach Sonnenuntergang gesprochen werden muß.“ Ich verstehe kein Wort, und das ist gut. Seine große warme Hand und das vielsprachige Durcheinander seiner Worte, das Geheimnis, bedecken mich wie breite Schwingen und beschützen mich. Nicht jeder halte die Regeln des Betens ein, meint er, denn man sei in dem Glauben, im Sommer, im Norden sei dies unmöglich, doch ganz im Gegenteil, dies sei gyönyöru, wunderbar. Er stehe frühmorgens um vier auf und spreche das morgendliche Schma, „noch bevor sich das Dunkelblau des Himmels ins Silbrige wandelt“, und dann lege er sich nicht mehr hin, denn es lohne sich nicht mehr, und auch am Abend sei er noch gegen elf wach, wenn bereits vollkommene Dunkelheit herrsche, um das abendliche Schma zu sprechen. Nachmittags schlafe er jedoch ein, zwei Stunden, so könne man das lösen. Obschon er auch da bedauere, sich hinzulegen, schade um jede Minute, so wunderbar sei der Sommer im Norden, das Morgengrauen, die Dämmerung und auch der Nachmittag, „das Licht sinkt gleichsam aus dem Himmel hinab“. All das sagt er auf Deutsch, und ich wundere mich, daß ich es doch verstehe. „Eines Tages sammelt uns der Ewige aus den vier Ecken der Erde zusammen und führt uns heim ins Land. Fremde sind wir hier. Erinnere dich immer daran, Fremde sind wir hier, im Norden. Und doch mag ich ihn, ich könnte mir für mich gar nichts anderes vorstellen. Seit Generationen sind wir hier und mögen, daß wir Fremde sind. Als würden wir unsere Wege rings um die heilige Leere ziehen. Doch indessen leben wir und mögen diese fremden Gerüche und Lichter und vor allem den Wald.“ Der Urgroßvater meines Urgroßvaters trägt dunkle Kleidung, hat einen langen Bart, und sein Gesicht ist ganz blaß. Als dächte er immer an etwas anderes, auch wenn er zu mir spricht und wenn er mich plötzlich in die Höhe hebt und anlacht. Doch es ist, als wäre auch ich nicht hier. Als wären wir alle immer woanders. Unsere Welten flattern kreuz und quer übereinander hinweg. Seine Augen treten jetzt tief in die Höhlen zurück, und seine Stimme ist merkwürdig heiser: „Nächste Woche verreisen wir, weit in den Süden. Wir gehen nach Ungarn. Man hat mich als Rabbi nach Nagyvázsony gerufen.“
Die Träume stolpern in meinem vollgestopften Zimmer übereinander, die Erinnerungen türmen sich erschöpft auf meinem Tisch, ich treibe unzusammenhängende Geschichten in mein Kaleidoskop. Plötzlich ist die Stille unerträglich, ich nehme meinen Mantel, will Straßen, Plätze, Menschen sehen. Mit meinen Stiefeln Kilometer von Asphaltmasse durchwalken. Berlin ist die Stadt der einsamen Spaziergänge. Du kannst planlos gehen, hier stößt du auf keine Hindernisse, gelangst nicht ans Meer, keine Mauer versperrt dir den Weg, du kannst dich nicht einmal in bedrohliche Stadtteile verirren, du kannst gehen, niemand hält dich auf.
Es ist März, der Schnee fällt, gefriert auf dem Asphalt. Ich muß mir die Nase putzen, bleibe stehen, krame in meiner Tasche, mein Blick fällt auf eine Gedenktafel, die davon berichtet, daß XY, ein jüdischer Schauspieler, Journalist, der Begründer von ich weiß nicht was, 1935 vor den Gesetzen des nationalsozialistischen Staates in die Schweiz geflohen sei, wo er zusammen mit seiner Familie Selbstmord begangen habe. Ich putze mir die Nase, drücke das kalte, feuchte Taschentuch in meiner Hand, gehe weiter. Jetzt spaziere ich an der Grunewalder S-Bahnstation am Gleis der Linie 17 entlang. Ich kann nicht ausrechnen, wie viele Juden hier in Züge gepfercht wurden, dabei hat man die Zahl Tag für Tag genau notiert. Nur stimmt die Summe nicht. Die Tafel hier spricht von 50 000, doch nach meiner Berechnung kommen 30.000 und mehr heraus, dann, nach einer anderen Berechnung, 42 000 und mehr. Eigentlich ist das egal, einige Tausend mehr oder weniger. Nicht wegen der Zahlen halte ich es nicht länger aus, sondern wegen der Präzision, der Tag für Tag notierten Todesabrechnung. Die Eisenschwere der fachgerechten Büroarbeit läßt mein Hirn fast explodieren.
Fieberhaft suche ich nach einem menschlicheren Denkmal, ich suche nach etwas wie dieser kleinen goldglänzenden Tafel unter meinem Stiefel, die von einem Ehepaar berichtet, das in diesem Haus wohnte, bevor …
Ich fahre mit der S-Bahn. Charlottenburg – großbürgerlich, breite Straßen, Fenster mit mehreren Flügeln, Stuckverzierungen, Stiefel mit hohen Absätzen klacken auf dem Asphalt, ein gut gepflegter Schäferhund winselt, weil er sein Herrchen verloren hat. Wer hat damals hier gewohnt? Niemand erinnert sich, nur die Häuser, die leeren Fensterscheiben sind da. Die Vergangenheit hat sich zu Spänen gewandelt. Wir gehen durch die Frühlingsstarre, auf dem Asphalt verstreute Sägespäne, wir stolpern nicht, über Späne stolpert man nicht, auf die tritt man, die Erde unter mir ist weich, die Vergangenheit der Erde, die gute Vergangenheit und die schlechte Vergangenheit, die gute Zukunft und die schlechte Zukunft, und bei diesem Spaziergang auf dem sich zwischen Erinnerung und Vorstellung dahinziehenden Asphalt entgleitet dem Bewußtsein die Gegenwart.
„Was meinst du“, fragte einer meiner amerikanischen Bekannten einen deutschen Bekannten, „was meinst du, wie lange wird das noch dauern? Wie lange noch müssen die Deutschen immer wieder davon reden?“ Mein deutscher Bekannter zuckte mit den Achseln: „Vielleicht auf ewig. Möglich, daß es nie vergeht, daß es immer so sein wird, daß wir diese Vergangenheit mitschleppen. Aber ist das so schlimm? Wäre es besser, zu vergessen?“
Wenn man häufig an die Vergangenheit denkt, so wie man in Berlin ständig an die Vergangenheit denkt, an Vergangenheiten verschiedenen Alters und verschiedener Nationalitäten, an unsere und an ihre, an die aus dem Osten und an die aus dem Westen, dann legt sich die Hysterie allmählich. Denn die Vergangenheit muß man nicht vergessen, man muß nicht über sie hinwegschreiten, sondern sie zart, mit ernst gemeinter Liebe in die Gegenwart hinüberheben. Sie streicheln, tätscheln, ihr einen Platz suchen, wo sie sich wohlfühlt, wo sie nicht ständig im Weg ist, „nur so“ ist. „Aber ihr habt damals doch noch gar nicht gelebt! Was haben die Enkel mit den Verbrechen ihrer Großväter zu tun?“ „Darum geht es nicht, ob man persönlich damit zu tun hat, sondern darum, daß es gut ist, sich daran zu erinnern.“ „Gut?“ „Ja, gut. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, daß du es nicht vergessen hast. Es ist gut zu wissen, daß damals das eine existierte und es jetzt etwas anderes gibt, und gerade deshalb muß man immer daran denken, damit einem in jedem Augenblick bewußt ist, daß das, was jetzt ist, nicht das ist, was damals war.“ In Berlin darf ich mit meinen Ängsten leben, hier sagt man nicht: „Hör schon auf, hast du’s noch nicht satt, ihr Juden könnt doch von nichts anderem reden.“ Hier darf ich vergessen. Es reicht, wenn sie sich erinnern. Berlin streichelt meine mit zerbrochenen Splittern bedeckten Träume; man sagt nicht, ich sei verrückt geworden und solle zum Psychologen gehen.
(...)