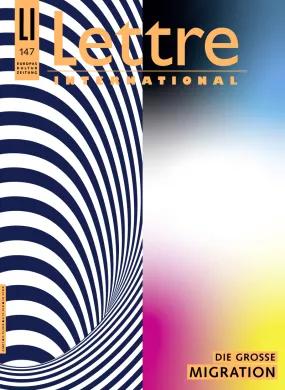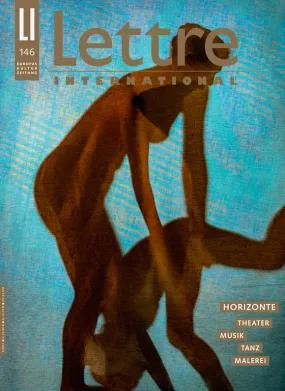LI 66, Herbst 2004
Die Schwadron Gottes
Auf dem Nationalkonvent der Republikanischen Partei in New YorkElementardaten
Genre: Literarische Reportage / New Journalism, Porträt
Übersetzung: Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
Textauszug
(...) Ein gewisser Glamour lag beim Parteitag der Republikaner in der Luft: Es war die Überzeugung, daß fehlender Patriotismus der Feind der Demokratie ist, daß eine Neigung zum Differenzieren eine Form des elitären Denkens und die einzige Stärke, die in der Außenpolitik zählt, der Stolz auf das eigene Land ist. In diesem geistigen Klima „ dessen Intoleranz zum Himmel stinkt „ hält sich auch die Vorstellung, daß die Ausländer Amerika nicht für seine Taten hassen, sondern für seine Werte, seine „Lebensweise". Wenn die Leute vom amerikanischen Imperialismus reden, heißt es, dann meinen sie eigentlich letztere „ nicht die destruktiven und mörderischen Geschäfte von Halliburton und der Carlyle-Gruppe, nicht die Seilschaften und das Decken der Saudis durch die texanischen Ölbarone, wie schockierend all das auch sein mag. Was die Ausländer eigentlich meinen, ist das selbstsichere Auftreten der Amerikaner im Alltag. Deswegen halten sie Amerika für eine Truppe im Kampf gegen andere Kulturen und Lebensweisen. Dieses Zeug inhalieren die Delegierten seit Jahren tief in ihre Lungen, und sie konnten auch bei diesem Parteitag nicht genug davon bekommen. „Die Muslime hassen uns einfach, weil wir die Freiheit lieben", sagte eine Frau aus Iowa mit einem Stoffelefanten auf ihrem Kopf. „Sie haben keine Kultur, und sie hassen uns dafür, daß wir eine großartige Kultur haben. Und die Bibel hassen sie auch."
„Wirklich?" fragte ich. „Die Iraker hatten schon vor Jahrtausenden eine Kultur, bevor die Bibel überhaupt geschrieben wurde."
„Was sagen Sie da?"
„Ich sage, die Muslime haben schon Tempel gebaut, als New York noch ein Sumpf war."
„Sind Sie für die Iraker?"
„Nein."
„Sie finden es richtig, daß unschuldige Leute auf dem Weg zur Arbeit umgebracht werden? Leute, die dann aus Fenstern springen müssen?"
„Sie hören mir nicht zu."
„Nein, mein Freund. Sie hören nicht zu. Diese Leute, für die Sie sind, versuchen unsere Kinder in ihren Betten zu ermorden. Wo kommen Sie überhaupt her, von der New York Times?"
Die Tribüne dieses Parteitags war weniger glamourös als die in Boston, weniger neongrell und persönlicher. Die Mannschaft um George Bush sollte diese Woche für ihren Machoauftritt nutzen und doch offenbaren, daß sie in der Defensive ist. Im Kern weiß diese Regierung, daß sie in Schwierigkeiten steckt. Sie kompensierte das beim Parteitag übermäßig, indem sie jede Erwähnung von Schwierigkeiten vermied und aus New York all die rechtslastigen Zirkel verbannte, die ihre eigentlichen ideologischen Reserven bilden. Daß die Frau aus Iowa die New York Times erwähnte, erinnerte mich daran, wie unerschütterlich die Republikaner an eine linke Verschwörung glauben. Sie nehmen die Welt in Begriffen der Verschwörung wahr, aber das Raster der Linkslastigkeit ist das verlogenste von allen. Selbst das amerikanische Fernsehen hat sich dem Ideal der amerikanischen demokratischen Anständigkeit verschrieben, das die Republikaner während dieser gesamten Woche zu verkaufen trachteten.
Die Worte „nine/eleven" wurden so oft ausgesprochen, daß sie wie eine Droge im Blut zu kreisen begannen. Niemand sprach ein Thema an oder erklärte eine Politik oder träumte einen Traum, das, die oder der nicht mit Rache zu tun hatte. Ein Republikaner aus Puerto Rico namens Luis Fortuno sprach auf der Bühne. Unterdessen winkte ein Schwall von Männern aus Texas mit ihren Hüten, als wären sie ein Mann und als würden sie etwas verabschieden, das wir anderen ganz deutlich erkennen könnten. Plötzlich wehte es einen von Fortunos Sätzen über die Reihen: „Präsident Bush ist entschlossen, seinen Ängsten (his panics) mehr Macht zu geben."
Ich dachte einen Augenblick darüber nach. „Das stimmt", sagte ich mir. „Das ist ganz offensichtlich richtig. Er gibt seinen Ängsten alle Macht, er überläßt ihnen eine ausschlaggebende Rolle bei der Ausarbeitung seiner Politik. Das ist es. Bushs Ängste sind das Wesen seiner gesamten Regierung." Ich sah wieder zur Bühne.
Fortuno: „Und zum ersten Mal sind seine Ängste ..."
„Ja", dachte ich. „Wenn er bloß seine Ängste unter Kontrolle hätte ..."
„Ja, zum ersten Mal ..."
„Lateinamerikaner (Hispanics)!", rief ich, „er will den Lateinamerikanern mehr Macht geben!"
„Genau!" sagte eine Frau neben mir, von deren Kopf kleine Raketen in den amerikanischen Farben baumelten.
Dabei hatte ich doch vorher sagen wollen, daß Fortuno recht hatte. „Was ist mit Ihren Ängsten? Mit unseren Ängsten?"
„Was sagst du, Süßer?"
„Nichts."
Wenn man sich Aufnahmen vom Parteitag der Republikaner im Jahr 1980 ansieht, erkennt man den Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, George H. W. Bush, wie er schüchtern die Truppen auf ein todsicheres Ziel einschwört: „Laßt uns vorwärts marschieren", trällert er, „und das Jahr 1980 nicht nur zu einem Sieg für Ronald Reagan, sondern auch für die USA und die Sache der Freiheit auf der ganzen Welt machen." Während Konfetti auf die Bühne zu rieseln beginnt, sieht man Frank Sinatra aus der Menge hervorstrahlen (er konnte es nie verwinden, daß John Kennedy 1962 Bing Crosby den Vorzug gab) und rechts neben der Bühne einen aufgeregten Mann, der sich mühsam unter Kontrolle hält: Es ist der Sohn des Kandidaten für das Vizepräsidentenamt, George. Dieser George wirkte damals sehr verloren und hatte einen etwas irren Blick „ wie auf den Photos aus der Zeit, als er Flieger war und auf diese Weise versuchte, Oklahoma gegen den Vietkong zu verteidigen.
Ungefähr ein halbes Jahrzehnt nach Detroit gelang es George mit Hilfe von Billy Graham, von der Flasche loszukommen. Dabei verbündete er sich zugleich mit Gott und der religiösen Rechten „ eine Allianz, die seine Politik von Grund auf verändern sollte und ihm zum Triumph über seinen Vater verhalf. Als Bob Woodward ihn vor nicht zu langer Zeit fragte, warum er seinen Vater vor Kriegsbeginn gegen Saddam Hussein nicht um Rat gefragt habe, antwortete George: „Wenn es um Stärke geht, ist er nicht der Vater, den man um Hilfe bitten kann. Es gibt einen Höheren Vater, den ich gefragt habe."
Sätze wie diese haben den Eindruck erweckt, daß George W. Bush ein fundamentalistischer christlicher Krieger ist oder zumindest ein zum Kampf entschlossener christlicher Soldat. Evangelisten, Pfingstler und Fundamentalisten glauben ganz offensichtlich daran, daß ihr Mann im Weißen Haus sitzt.
(...)