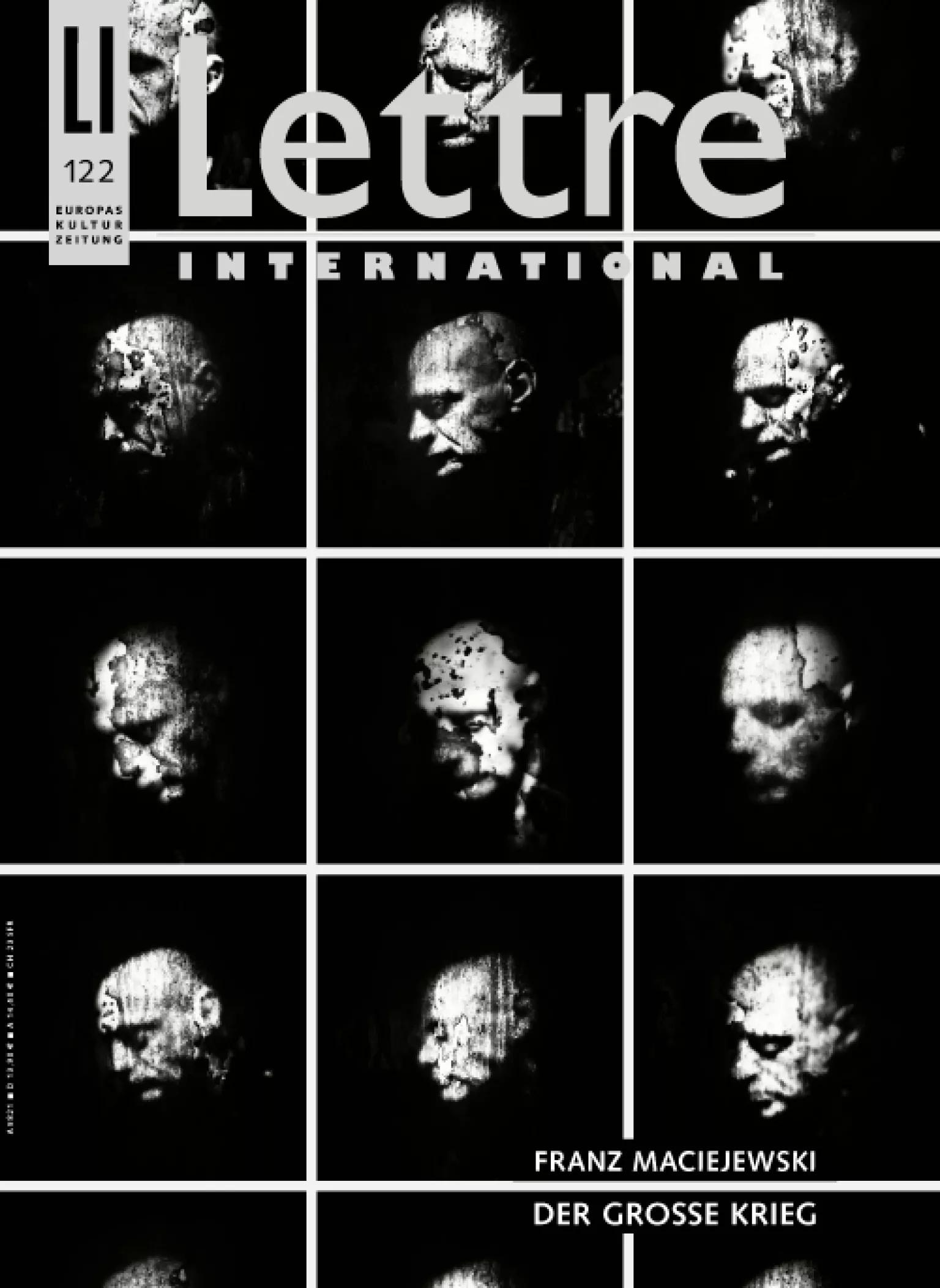LI 122, Herbst 2018
Mit Orwell in Myanmar
Vom britischen Kolonialismus zum Land der Generäle – eine SpurensucheElementardaten
Textauszug
(…)
Die Novelle Tage in Burma ist in dem Ort Katha angesiedelt, einer der letzten Stationen Orwells in Burma; hier bildete der junge Kolonialbeamte bis Juni 1927 lokale Hilfskräfte für die Polizei aus. Fast ein Jahrhundert später bekam ich unweit dieses Städtchens die Aufgabe, eine Klinik zu betreuen. Meine Zeit dort sollte auch zu einer Reise auf den Spuren des großen Schriftstellers werden.
Seit der Jahrtausendwende bahnte sich in Myanmar eine Explosion der HIV-Infektionen an, wie in Thailand zwei Jahrzehnte zuvor. Im Grunde war sie, den Patientenzahlen unserer Kliniken nach, schon voll im Gange. Man sprach bereits vom asiatischen Epizentrum. Die Edelstein- und Goldminen im Norden Myanmars, um deren einträgliche Geschäfte die Militärregierung mit den Minderheitenarmeen kämpfte, zogen Prostitution an. Die Wanderarbeiter, die dort unter elendigen Verhältnissen schufteten und hausten, wurden vom nahen „Goldenen Dreieck“ mit billigem Heroin versorgt, das sie sich in shooting galleries mit mehrfach gebrauchten Spritzen in ihre Venen jagten. Sie trugen den Virus weiter in ihre entlegenen Heimatdörfer, zu ihren Frauen, die sie an ihre Kinder weitergaben. Die Warteräume der Klinik glichen einer Hausarztpraxis: vom Säugling bis zur Großmutter, vom Lehrer bis zum Tagelöhner waren alle Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten vertreten. AIDS hatte nach und nach das Stigma einer Geschlechtskrankheit verloren, es war zu einer Volkskrankheit geworden.
Für mich als Arzt war es dennoch eine erfüllende Aufgabe, denn seit die Preise der HIV-Medikamente dramatisch gesunken waren, konnten Millionen AIDS-Kranke, Lazarus gleich, vom Sterbebett auferstehen und nach wenigen Monaten der Behandlung zu ihren Familien und auf ihre Felder zurückkehren. Die HIV-Infektion war zu einer behandelbaren Erkrankung geworden. Chronisch, aber mit der richtigen Therapie konnten eine beinahe normale Lebensqualität und Lebenserwartung erzielt werden.
Mit dem Fahrrad brauchte ich nur wenige Minuten zur Klinik. Vorbei an improvisierten Tankstellen, an denen Kinder oder junge Frauen Benzin in Plastikflaschen anboten. Im Morgennebel kamen mir in safranfarbenen Gewändern Mönche des benachbarten Klosters entgegen. Im Gänsemarsch gingen die jungen Männer barfüßig und mit gesenkten Köpfen von Haus zu Haus, wo sie von Gläubigen Reis mit Currysauce und Bananen für ihr Frühstück sammelten. Die jüngeren unter ihnen konnten der Versuchung nicht widerstehen und lächelten ihrem neuen Nachbarn vorsichtig zu.
LEBEN UND LEIDEN IN BURMA
An arbeitsfreien Sonntagen saß ich vor dem Haus in einem Korbsessel, las Bücher und beobachtete die Kreuzung, in deren Mitte der Uhrturm stand. Nur wenige schauten zu mir hinüber von ihren vorbeirollenden Pferdekarren, von den mit Knoblauch, Kohle, Fässern oder Sand meterhoch beladenen Tragflächen der kleinen chinesischen Traktoren, von den Pick-ups, auf denen Passagiere wie Trauben hingen, von den Militärlastwägen. Nicht die pinkfarben bekleideten kahlgeschorenen Nonnen, die mit ihren archaischen Bambussonnenschirmen und gefalteten braunen Tüchern auf dem Kopf vorbeimarschierten, nicht die Kinder, die auf viel zu großen Fahrrädern balancierten, nicht die vierköpfigen Familien, die auf ihrem Moped aufgereiht beim Telefonmädchen vor meinem Haus vorfuhren.
Wenn sie mich jedoch erblickten, konnten sie sich nicht sattsehen an mir, machten große Augen, schauten noch lange zurück. Ich war der einzige Weiße in der Stadt.
(…)
Tage in Burma ist eine radikale Abrechnung mit dem britischen Kolonialismus aus der Frustration eines sensiblen, kritisch denkenden Mannes, die sich der junge Polizeibeamte Eric Arthur Blair, der spätere George Orwell, von der Seele schrieb. Orwell ging 1922 für fünf Jahre als Polizist der Imperial Police Force nach Burma, damals Teil Britisch-Indiens. Die Provinz galt als die gewalttätigste Ecke des Empires. Orwell war einer von nur neunzig britischen Polizeibeamten, denen 13 000 burmesische Polizisten unterstanden. Viele Briten sahen im Alkohol die Hauptursache der Unruhe und empfahlen totale Prohibition. Andere identifizierten die Gründe in „demoralisierenden“ westlichen Filmen, wieder andere in der schwülen Hitze und den Mückenschwärmen. Analysen über die „angeborene Kriminalität im burmesischen Charakter“ kursierten.
Nur selten stellten sich die Kolonialmachthaber die Frage, ob diese Zustände etwas mit ihrer Präsenz vor Ort zu tun haben könnten. Die britische Regierung hatte die Autorität der Dorfältesten abgeschafft, die lokalen Fürsten entmachtet und durch zumeist indischstämmige Bürokraten ausgetauscht. Ende der zwanziger Jahre bereits hatte die Hälfte der burmesischen Bauern des fruchtbaren Irrawaddy-Deltas ihre Felder an indische Geldverleiher verloren. Die jahrhundertealten buddhistischen Klosterschulen waren durch das britische Unterrichtssystem mit christlichen Missionseinrichtungen ersetzt worden. Ein moralisches Vakuum war entstanden.
Orwells Kolonialismuskritik in seiner autobiographisch gefärbten Novelle zeichnet ein deprimierendes Sittenbild britischer Herrenmenschen in einem kolonisierten Land. Doch erst die späteren Werke, Farm der Tiere und 1984, verhalfen Orwell im Burma der Militärdiktatur zu einem Prophetenstatus ex negativo.
(…)
Katha erschien auf Anhieb als sympathisches, idyllisches Städtchen. Im Hintergrund eine malerische Bergkulisse. Die Uferpromenade lud zum Flanieren ein. Zwei Pagoden, eine von imposanten goldenen Löwen bewacht, begrüßten einen. Mehr als hundert Jahre alte, große Regenbäume spendeten Teehäusern, Märkten und Straßen wohltuenden Schatten.
Am von Unrat verschmutzten Pier wimmelte es von Menschen, die Waren und Tiere verluden. Tongefäße glänzten in der Sonne und warteten säuberlich gestapelt auf Kunden. Dreirädrige chinesische Traktoren, Minimalkonstruktionen aus Ladefläche, Lenkstange und lärmendem Motor, konkurrierten auf dem Platz um Transportaufträge. Teashops und Läden säumten die Straßen, Motorräder und Fahrräder wichen im Schrittempo streunenden Hunden und Kühen aus.
Vermutlich hatte sich am Erscheinungsbild des Städtchens seit Orwells Aufenthalt wenig geändert. Die Straßen waren geteert, es dominierte Holzarchitektur. Doch die im Buch beschriebenen Orte konnte ich kaum ausmachen. Ich fand weder die alte Kapelle, in der sich die kleine britische Gemeinde und zwei Anglo-Burmesen allmonatlich zu einem Gottesdienst trafen, noch den britischen Friedhof. Dieser war ein Jahrzehnt zuvor außerhalb der Stadt verlegt worden. Die Gegend, in welcher der Holzhändler John Flory lebte, war einzugrenzen, aber nicht genau auszumachen.
Das Gebäude des Britischen Clubs, einst „das wahre Zentrum der Stadt“ und Mittelpunkt des kolonialen Soziallebens, existierte noch. „In jeder Stadt in Indien ist der europäische Club die spirituelle Festung, der wahre Sitz der britischen Macht, das von einheimischen Beamten und Millionären ersehnte und nie erreichte Nirwana“, so Orwell. Das unscheinbare Holzgebäude beherbergte eine staatliche Kooperative, die den Bauern landwirtschaftliche Produkte abkaufte und diese nach Mandalay verschiffte. Der Direktor bot mir freundlich grünen Tee aus der Thermosflasche an. Er war sporadische ausländische Besucher gewohnt und führte mich herum. Er habe Burmese Days gelesen, eine alte Ausgabe, die ihm ein in der Stadt lebender Inder geliehen hatte. Er zeigte mir die Räume, wo Europäer in Korbsesseln zerfallende Bücher und vergilbte Magazine gelesen hatten, und führte mich in den Keller, der die schäbigen Billardtische beherbergt hatte, die „wegen Scharen von um die Lampen herumschwirrender Insekten, die auf den Stoffüberzug herabfielen“ ohnehin nur selten benutzt wurden. Der Keller mit Schreibtafel und Tischen diente nunmehr als Schulungsraum. Zur Kolonialzeit gehörten sogar ein indischer Butler und ein punkah wallah, der die Ventilatoren per Hand bediente, zum Inventar. Vom einstmals grandiosen Garten war wenig geblieben, und auch der Ausblick auf den Fluß war hinter wild wuchernden Pflanzen fast verschwunden. Im angrenzenden Tennisklub spielten die Reicheren nach wie vor ihre Runden. Gegenüber konnten sie in der Beer Station mit einem verjüngenden Spirulina-Bier danach ihren Durst löschen.
(…)
YANGON
Gelegentlich fuhr ich für Meetings nach Yangon zur Zentrale von Ärzte ohne Grenzen. Nach dem archaischen Leben in der Provinz erschien mir die Vier-Millionen-Metropole, die bis 2005 Hauptstadt des Landes war, geradezu weltläufig. Ich übersah Schmutz und Verfall, ich bemerkte hohe Gebäude, neureiche SUVs, Schaufensterauslagen, Supermärkte, in denen ich mich eindecken konnte mit allem, was im Norden unbekannt war. Auch Orwell muß die raren Reisen in die Metropole als Wohltat empfunden haben: „Oh, die Freude dieser Rangun-Besuche“, sagt Flory. „Der Ansturm auf Smart und Mookerdums Buchladen für die neuen Romane aus England, das Abendessen im Anderson’s mit Beefsteaks und Butter, die achttausend Meilen auf Eis gereist sind, die herrlichen Saufgelage!“
Der mit angeblich 9 000 Goldstäben bedeckte Stupa der Shwedagon-Pagode überragt die Stadt. Er ist zentraler Orientierungspunkt und in der Abendsonne oder seiner strahlenden Nachtbeleuchtung kann man sich seiner magischen Anziehungskraft kaum entziehen. Der Reichtum der Verzierungen der ihn umgebenden Schreine kontrastierte mit dem allgemeinen Elend der Metropole. Wie schon die Könige, verstanden sich auch die Generäle als gute Buddhisten und bedachten großzügig ausgewählte Klöster, beschenkten Mönche mit Gewändern und Goldplättchen, ließen Pagoden vergolden und neue errichten und erhofften, sich damit von Übeltaten reinzuwaschen. Diese Doppelmoral hatte Orwell schon in Tage in Burma aufs Korn genommen.
(…)
Am Yangon-Fluß stehen noch die opulenten britischen Verwaltungsgebäude, viele dem Verfall preisgegeben, andere zu Botschaften oder Ministerien umfunktioniert. Seit der politischen Öffnung Myanmars müssen sich die wenigen Kulturaktivisten, die sie als historisches Erbe für die Nachwelt erhalten möchten, mit internationalen Investoren und korrupten Beamten auseinandersetzen. Den verarmten Yangoner Normalbewohnern galt die Kolonialarchitektur ohnehin bloß als verfallene Kulisse. Sie sehnten sich nach Neuem, Strahlendem, nach Beton und Glas. Nun wächst der Druck, Yangon in ein weiteres Bangkok oder Singapur zu verwandeln.
AUFBAUHELFER
Bis zur schrittweisen Übergabe der Macht an die zivile Regierung ab 2011 war Myanmar weitgehend isoliert und von internationalen Helfern und Experten größtenteils verschont geblieben. Es gab nur wenige, meist medizinische NGOs, welche die Militärjunta geduldet hatte. Einen Steinwurf von der Villa der damals unter Hausarrest stehenden Friedensnobelpreisträgerin und heutigen de facto-Staatschefin Aung San Suu Kyi entfernt, vor der Yangoner Nobeldisco BME, parkten samstags abends die schweren Landcruiser der UNO neben denen der Diplomaten und armeenahen Geschäftsleute.
Seitdem ist die Helfer-Community privater, staatlicher und UN-assoziierter Provenienz stark angeschwollen. Alle sind gekommen, um das Land zu entwickeln: Gesundheits- und Ernährungsprogramme zu etablieren, Schulen zu bauen, die Zivilgesellschaft zu stärken. Hehre Ziele, doch die verschiedenen Player agieren zumeist mehrgleisig und ohne wechselseitige Koordination. Häufig arbeiten sie an den Bedürfnissen ihrer Zielgruppen vorbei, Hauptsache, die Spender sehen schöne Zahlen und Ergebnisse. Auch Wirtschaftsabenteurer aller Art suchen Glück und schnelles Geld, sie bieten sich als Geburtshelfer eines neuen „asiatischen Tigers“ an. Restaurants und Treffpunkte der Expat-Community sprießen aus dem Boden.
Der Heiligenschein des selbstlosen guten Samariters, der Mitarbeiter großer staatlicher und UN-Agenturen anfänglich umschweben mag, zerbricht an derartigen Orten. Viele der westlichen Angestellten wissen wenig über das Land, in das sie entsandt werden, und über die Menschen, denen sie helfen sollen. Nicht selten beseelt von Helferromantik, stürzen sie sich unkritisch in vorgegebene Arbeit, angesichts der bitteren Realität sind viele bald ausgebrannt und enttäuscht. Für eine tiefgründige Auseinandersetzung reicht die Zeit oft nicht.
In einer Bar, in der fast ausschließlich Ausländer verkehrten, vernahm ich unter lautem Gelächter, wie westliche Helfer beim Whisky zynische Diskussionen über ihre Jobs, über astronomische Gehälter und darüber, wie gut sich so ein Engagement in ihrem Lebenslauf machen würde. Nachdem das Militär die Verteilung der Hilfsgüter übernommen hatte, war die Empörung groß, die Karawane der Experten mußte enttäuscht wieder abziehen.
Begegnungen dieser Art erinnern mich an Tage in Burma. Missionarisch-religiöse Ideale prägen nicht wenige Kolonialbeamte, denn der weiße Mann hatte sich die Bürde auferlegt, dem armen „schwarzen Teufel“ ins Licht der Zivilisation zu verhelfen. Sie verstehen sich als „Fackelträger der Entwicklung“, bevor sie selbst vom System korrumpiert werden.
(…)
Heute spricht man nicht mehr von Bekehrung oder „Bürde“, sondern von Entwicklung, Zusammenarbeit, Ausbildung, Empowerment, Dialog. Doch viele der etablierten „Helfer“ leben auch heute in einer rhetorischen Wolke von Humanität, Gleichheit, Brüderlichkeit, die einer Lüge gleichkommt. Viele nehmen die Gastländer wahr wie einst Albert Schweitzer: als Orte, an denen es nichts von Wert gibt, keine Kultur, keine Religion, keine Geschichte. All das können und wollen sie erst dort etablieren. Der Britische Club wurde durch subtilere Inkarnationen ersetzt.
(…)