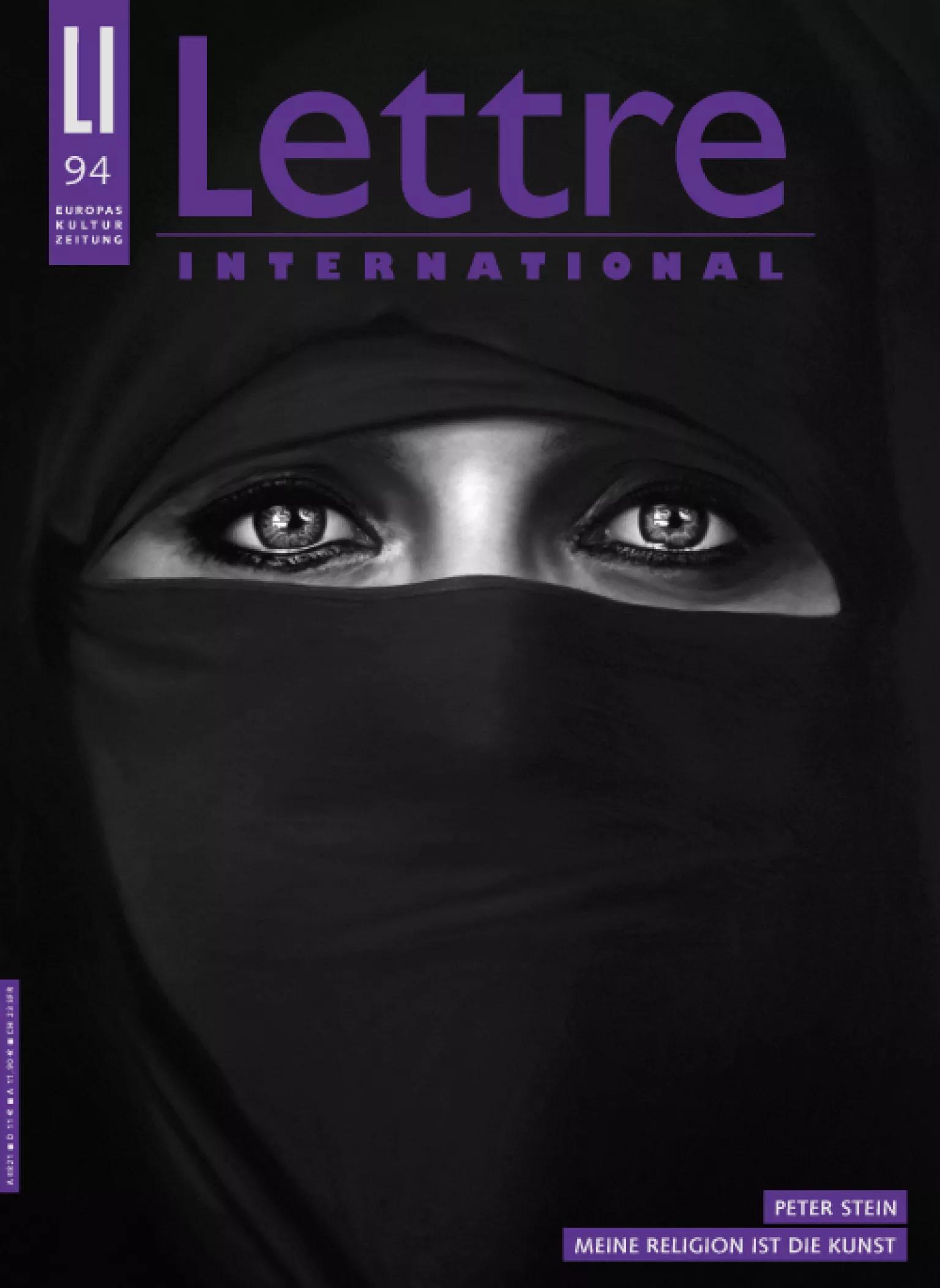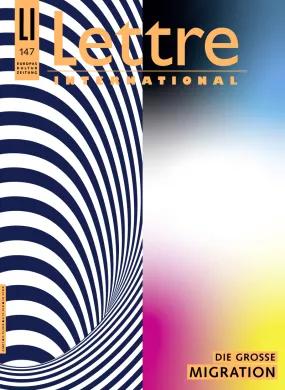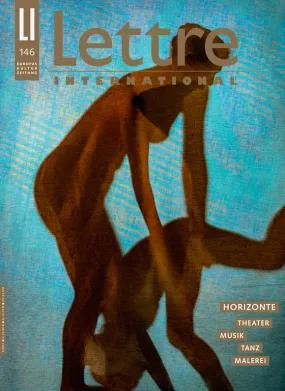LI 94, Herbst 2011
Spatzendämmerung
Kein Wetzen der Schnäbel, kein Gezwitscher mehr in unwirtlichen StädtenElementardaten
Genre: Erinnerung, Literarische Betrachtung
Textauszug: 6.800 von insgesamt 58.000 Zeichen
Textauszug
(…) Zählungen der Vogelschutzverbände belegen die drastischen Rückgänge der Populationen des Haussperlings in den westlichen Städten Deutschlands und Europas durch Veränderungen der Umwelt. Seit 1980 hat sich der Bestand um über sechzig Prozent vermindert: Der Haussperling steht auf der Vorwarnliste der gefährdeten Arten. In Hamburg, Duisburg, Köln, Stuttgart, Hannover und München sind keine Spatzen mehr zu sehen, ebensowenig wie in den Innenstädten von Amsterdam oder London, den wohlhabenden Vierteln von Paris und Prag. Vermißt sie jemand? Das Verschwinden dieser kleinen Vögel, die zu den ältesten Begleitern des Menschen in Mitteleuropa gehören und deren Name Kosename für Kinder und Frauen ist, löst keinen Aufschrei aus wie das Aussterben von Adlern in Gebirgen, von Walen und Delphinen in entfernten Meeren. Ein Viertel der bekannten Vogelarten ist vom Aussterben bedroht. Eine Vogelart pro Jahr geht verloren. Wie oft haben wir solche Meldungen gehört? Doch bleibt, was sich dahinter verbirgt, seltsam ungreifbar. Das Artensterben passiert auf dem Bildschirm. Da treten Nahes und Fernes unterschiedslos vor uns. Das Ferne rückt näher; es bewegt uns, rührt uns zu Tränen, aber es gehört auch wieder nicht zu uns, läßt uns kalt. Das Nahe hingegen entzieht sich, versinkt in Belanglosigkeit, Gleichförmigkeit. Mit der architektonischen Monotonie der Städte geht eine seltsame Blindheit ihrer Bewohner einher. Wie benebelt bewegen wir uns zielstrebig von hier nach dort, ohne das Dazwischen wahrzunehmen, Kreuzungen, Terminals, Parkhäuser, öde Flächen, tote Ecken, Durchgänge, Tunnels. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sind mit wichtigen Dingen beschäftigt. Wir bereisen die Welt. Aber ist das, was uns umgibt, noch eine Welt? Und das, was uns im Ausschnitt des Küchenfensters entgegentritt, nicht nur eine diffuse Spiegelung unserer selbst?
(…)
Seit dem Verschwinden der Spatzen habe ich bemerkt, wie viele Tiere gar nicht mehr oder nur noch in geringer Anzahl in meiner Umgebung leben. Tiere, die vor zehn, zwanzig Jahren noch so selbstverständlich zum städtischen Wohnen gehörten, als wären sie Teil des Inventars. Der Schmetterlingsstrauch auf dem Balkon war von Admiralen umflattert. In Sommernächten blieben Fenster geschlossen, um nicht Scharen von Schnaken anzuziehen. Man fand Ameisen in Zuckerbüchsen, Taubenschwänzchen auf dem Balkon, an nassen Tagen ringelten sich Regenwürmer auf dem Grünstreifen. Es gab scharenweise Stubenfliegen, Nachtfalter und Schnecken; es gab Tausendfüßler und Maikäfer, Fledermäuse und Grillen; es gab Rotkehlchen und Buchfinken und Mauersegler, die im Sommer die Höfe mit ihren gellenden Rufen erfüllten. Von den Sängern in meinem Hof sind gerade noch ein paar einzelne Meisen- und Amselpaare übrig; Elstern, Krähen und Straßentauben scheinen am robustesten zu sein. Diese Beobachtungen stehen durchaus nicht im Gegensatz zu Publikationen, die eine Zunahme der Wildtierbestände in Städten feststellten. In Berlin mit seinen vielen unbebauten Grundstücken, vernachlässigten Bahndämmen und unrenovierten Altbauten gibt es so viele Spatzen wie eh und je.
(…)
Besonders abstoßend sei ihr Liebesleben. Denn hier zeige sich am deutlichsten der unüberwindliche Abstand, der zwischen Wesen herrscht, die nur ihrer Natur (physique) frönen, und uns anderen, denen jede Tätigkeit Anlaß ist zu sittlicher Vervollkommnung:
„Die Männchen kämpfen bis zum Äußersten um den Besitz der Weibchen, und dieser Kampf ist so gewalttätig, daß sie dabei häufig zu Boden fallen. Es gibt wenige Vögel, die so hitzig und so leistungsfähig in der Liebe sind. Man sieht sie sich bis zu zwanzigmal in Folge paaren, immer mit demselben Eifer, denselben Erschütterungen, denselben Ausdrücken der Lust; eigenartig ist, daß das Weibchen als erste die Geduld zu verlieren scheint bei einem Spiel, das sie offenbar weniger ermüdet als das Männchen, das ihr aber auch viel weniger gefallen dürfte, da es keinerlei Vorspiel gibt, keinerlei Zärtlichkeiten, keinerlei Variation der Sache selbst; viel Ungestüm ohne Zartheit, stets hastige Bewegungen, die nur von dem Bedürfnis an sich zeugen; man vergleiche das Liebesspiel der Taube mit dem der Sperlinge, und man wird darin all die feinen Unterschiede zwischen rein körperlichem und sittlichem Verhalten finden.“
(…)
Was geschieht mit uns, wenn Tierarten verschwinden, die wir kannten? Rachel Carson veröffentlichte in ihrem „Umweltklassiker“ Der stumme Frühling (1962), in dem sie die Vernichtung von Vögeln durch den Einsatz hochgiftiger Pestizide anprangert, Reaktionen von Menschen, an deren Wohnorten DDT gespritzt wurde: „Nicht ein Laut vom Gesang eines Vogels war zu hören“, heißt es in einer Mitteilung an die Autorin. „Es war gespenstisch, geradezu beängstigend.“ In einem Leserbrief steht: „Kann sich jemand etwas so Freudloses und Ödes vorstellen wie einen Frühling ohne den Gesang einer Wanderdrossel?“ Andere sprechen von „einem jammervollen, herzzerreißenden Erlebnis“, von „unerträglicher“ oder „unheimlicher“ Leere.
Ein Frühling ohne Vogelstimmen ist kein Frühling. Ein Mensch, der keine Vögel mehr hört, ist trotz seines materiellen Reichtums ein bedauernswertes Geschöpf. Das ist Carsons Argument gegen den „chemischen Todesregen“. Nicht die Wissenschaft sieht sie als Gegnerin, sondern den Begriff „Herrschaft über die Natur“, der aus der „Steinzeit der Naturwissenschaften“ stamme. Es sei beängstigend, folgert sie, daß diese „primitive Wissenschaft“ im Kampf gegen einzelne Tierarten heute mit den modernsten und fürchterlichsten Waffen ausgerüstet sei und damit die ganze Welt gefährde.
Der amerikanische Ameisenforscher und Soziobiologe Edward O. Wilson argumentiert 1984 ähnlich: Die Zerstörung des brasilianischen Regenwaldes zum Zweck der Ernährung einer wachsenden Zahl von Menschen vergleicht er mit dem Verfeuern eines Renaissancegemäldes, um das Abendessen kochen zu können. Der Wert der bedrohten Arten sei für Menschen unschätzbar. „Jede einzelne Spezies, die man aussterben läßt, ist (...) für uns alle ein unersetzlicher Verlust.“ Menschen seien „zu einem Gutteil gerade aufgrund ihrer besonderen Beziehungen zu anderen Organismen menschlich.“ Diese Beziehungen bildeten, „die Matrix, von der aus sich der menschliche Geist entwickelte und in der er dauerhaft gründet“, und nur diese tief eingewurzelte Biophilia könne die Voraussetzung für eine dauerhafte „Ethik der Naturbewahrung“ bilden. Für Wilson geht der Fortschritt der Wissenschaft mit einem vertieften Verständnis von Naturschutz Hand in Hand: „In dem Maß, in dem wir andere Organismen verstehen lernen, werden sie auch in unserer Wertschätzung steigen.“ Sein Glaube an eine prinzipiell naturbewahrende Naturwissenschaft erwies sich jedoch als naiv.
(…)