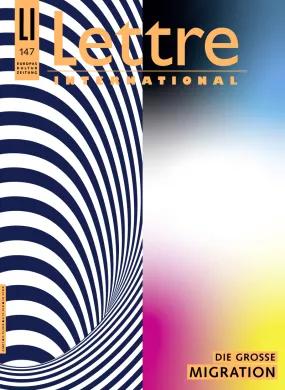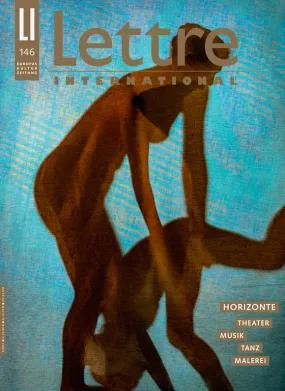LI 64, Frühjahr 2004
Afghanische Anarchie
Scheiternde Aufbaustrategien, Rückkehr der Kriegsherren und TalibanElementardaten
Genre: Bericht / Report
Übersetzung: Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
Textauszug
Ende Dezember 2001 fuhr Hamid Karsai zum ersten Mal seit dem Sieg der Alliierten über die Taliban nach Kabul. Als ein Mitglied des Stammes der Kandahari hatte er selbst an den Kämpfen um seine Heimatstadt teilgenommen. Erst Anfang desselben Monats hatten sich endlich alle gegen die Taliban verbündeten Parteien unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geeinigt und in Bonn einen Vertrag unterschrieben, der Karsai zum Vorsitzenden der neuen Übergangsregierung Afghanistans erklärte.
Karsai, ein Stammesführer und Angehöriger der ethnischen Mehrheit der Paschtunen, kam in einem amerikanischen Militärflugzeug nach Kabul. Als er am Abendin der Hauptstadt anlangte, erwartete ihn der Kriegsherr General Mohammed Fahim am Flughafen. Fahim ist Tadschike und stammt wie sein verstorbener Führer Ahmad Schah Masud aus dem Pandschirtal. Er hatte die Shura-e Nazar oder "Nordallianz" befehligt, die gemeinsam mit den Truppen der USA gegen die Taliban um Kabul gekämpft hatten. Jetzt war er Verteidigungsminister in Karsais Regierung.
Fahim näherte sich dem Flugzeug in Begleitung von fast hundert Leibwächtern, Gefolgsleuten und Ministern, alle bis an die Zähne bewaffnet. Karsai verließ das Flugzeug mit nur vier Begleitern. Als sich die beiden Männer auf dem Asphalt die Hände reichten, schien Fahim verwirrt. "Wo sind Ihre Männer?", fragte er. Karsai erwiderte mit seiner entwaffnenden Sanftheit: "Aber General, Sie sind meine Männer. Sie alle sind Afghanen und meine Männer. Wir sind jetzt vereint. Dafür haben wir doch den Krieg geführt und das Bonner Abkommen unterzeichnet, oder nicht?"
Karsai erzählte mir diese Anekdote eines Abends im vergangenen Spätsommer in Kabul. In den 23Jahren, in denen ich nun über den Krieg in Afghanistan schreibe, habe ich wohl keine andere Geschichte gehört, die die heutige Situation des Landes besser auf den Punkt bringt. Denn sie macht deutlich, welche unterschiedlichen Ziele die Afghanen nach wie vor verfolgen. Obwohl General Fahim heute mächtiger ist als je zuvor und obwohl er über eigene Streitkräfte und Geldquellen verfügt, ist er im wesentlichen ein Mann der Vergangenheit. Fahim begreift Afghanistan noch immer als ein Land, das sich über die Volkszugehörigkeit und die Herrschaft der einzelnen Stämme definiert. Er geht davon aus, daß er mit den Waffen seiner Anhänger Macht ausüben kann.
Fahim hat sich daher von März 2002 bis September vergangenen Jahres geweigert, das Verteidigungsministerium gemäß Vereinbarung zu reformieren und seine tadschikischen Generäle durch ein ethnisch ausgeglicheneres Offizierskorps zu ersetzen. Diese Reform ist jedoch Bedingung für ein 200 Millionen Dollar schweres UN-Vorhaben zur Auszahlung und Entwaffnung von 100 000 Milizen, die im Dienst verschiedener Kriegsherren stehen. Fahim versuchte eindeutig, diese Reform zu verhindern – bis ihn die USA so stark unter Druck setzten, daß er einlenken mußte. Seit September hat der Verteidigungsminister nun begonnen, die von der UNO geforderten Maßnahmen umzusetzen. Abgeschlossen sind sie jedoch längst nicht.
Im Gegensatz dazu verfolgt Karsai, ein gebildeter und sehr belesener Mann, die Vision eines modernen, demokratischen Afghanistan, das unter den Staaten eines Tages kein Paria mehr sein wird. Karsai will, daß sein Kabinett Vertreter jener verschiedenen Ethnien versammelt, die einander bekämpfen, seit die damalige Sowjetunion 1989 ihre Truppen aus Afghanistan abzog. Er hielt es für überflüssig, bei seiner Ankunft in Kabul Dutzende Angehörige seines Stammes der Kandahari im Flugzeug mitzunehmen, nur um die Kriegsherren mit einer Entourage zu beeindrucken. Er wollte damit nicht zuletzt ein Beispiel geben.
Gewöhnliche Afghanen verstehen solche Symbole und Gesten, denn in diesem Land gelten Körpersprache und Taten weitaus mehr als Worte. Dennoch fragten sich alle Beteiligten vom ersten Tag an, ob die mächtigen Länder – allen voran die USA – Karsais demokratische Vision oder Fahims Festhalten am Status quo unterstützten. Würde sich die Regierung Bush letztendlich nicht doch für die billigere und einfachere Lösung entscheiden und den Kriegsherren die Stange halten, sofern diese sich mit dem Westen gegen die Taliban verbündet hatten? Oder wollten die USA wirklich dabei helfen, aus einem Land ohne funktionierenden Staat oder nationale Einheit eine Nation zu schmieden? Bis vor kurzem jedenfalls haben sich die USA an die Kriegsherren gehalten.
Während Amerika in Kabul die Regierung Karsais unterstützt, sind die US-Truppen auf dem Land Fahim und anderen Kriegsherren nicht mit der nötigen Entschlossenheit entgegengetreten. Bisher haben die USA gegen deren brutale Menschenrechtsverletzungen, deren Heroinschmuggel, Mißachtung der Zentralregierung, Unterhalt und Ausbau ihrer Privatreiche und Widerstand gegen die Demokratisierung so gut wie nichts unternommen. Amerika stellt weiterhin Geld für Hilfsprojekte und für den Aufbau der neuen Armee- und Polizeikräfte zur Verfügung. Es hat aber seine Macht längst nicht im erforderlichen Ausmaß dafür eingesetzt, daß Afghanistan auf dem Weg zu einer demokratischen Selbstverwaltung vorankommt.
Im Spätsommer 2003 steckten die US-Streitkräfte im Irak fest, und Saddam Hussein war immer noch in Freiheit. In diesem Moment scheint die Regierung Bush etwas erlebt zu haben, das mir ein amerikanischer Diplomat in Kabul als "eine Eingebung" beschrieb. Denn da im Irak keine Wende in Sicht war und keine Errungenschaft die Begeisterung der Amerikaner für ihren Präsidenten am Beginn des Wahljahres zu wecken vermochte, entdeckten dessen Ratgeber Afghanistan: Afghanistan mußte in eine Erfolgsgeschichte verwandelt werden. Wenn man schon Osama Bin Ladens nicht habhaft wurde, so sollten wenigstens afghanische Präsidentenwahlen stattfinden, die sich als großer Fortschritt im Krieg gegen den Terrorismus darstellen ließen. Dafür war mehr Geld nötig. Der Wiederaufbau des Landes mußte angekurbelt und die Gründung neuer afghanischer Sicherheitskräfte beschleunigt werden. Außerdem, so der Diplomat, erkannten die USA an diesem Punkt, daß zur Durchführung dieser Vorhaben die Kriegsherren neutralisiert werden mußten.
Zalmay Khalilzad, der neue amerikanische Botschafter in Kabul und Sondergesandte des Präsidenten in Afghanistan, beschreibt die Politik seines Landes allerdings etwas anders. Er erläuterte mir im vergangenen Dezember, daß seine Regierung durch massive Investitionen und einen forcierten Wiederaufbau nicht nur Afghanistans Friedensprozeß vorantreiben, sondern vor allem die eigenen Truppen so schnell wie möglich zum Abzug bereit machen will.
Daher bestehen die USA auch darauf, daß die Wahlen wie in den Bonner Verträgen vorgesehen bis zum Juni abgehalten werden, obwohl fast alle anderen maßgeblichen Akteure – die Vereinten Nationen, die meisten Länder der EU und der NATO, westliche und afghanische nichtstaatliche Organisationen und viele Afghanen – darauf drängen, diese Wahlen um wenigstens ein Jahr zu verschieben. So viel Zeit sei nötig, argumentieren sie, um die Sicherheitslage zu verbessern, die Infrastruktur aufzubauen, die Zentralregierung zu stärken und wichtige Bauvorhaben zu vollenden. Letzten Endes entscheidet Karsai über den Wahltermin, doch laut Auskunft von Mitarbeitern der Vereinten Nationen ist ein so großer Teil Afghanistans nach wie vor akutes Kriegsgebiet, daß wenigstens die Hälfte von Karsais Ministern eine Verschiebung der Wahlen befürwortet. "Die Sicherheitslage muß sich verbessern und der Wiederaufbau ernsthaft in Angriff genommen werden, bevor Wahlen stattfinden können", hat Vizepräsident Amin Arsala demgemäß im Dezember erklärt. Auch Karsai gibt zu, daß Afghanistan "nur vierzig oder fünfzig Prozent der Verwaltungskapazität erreicht hat, die in einem Land wie unserem erforderlich ist." Dennoch haben er selbst und seine engsten Berater sich dafür ausgesprochen, die Wahlen so bald wie möglich abzuhalten. Gemeinsam mit den USA versucht die afghanische Regierung, ihr Land als stabil darzustellen und den Eindruck zu erwekken, daß es den Krieg hinter sich gebracht hat und in der Lage ist, freie und gerechte Wahlen abzuhalten.
(...)