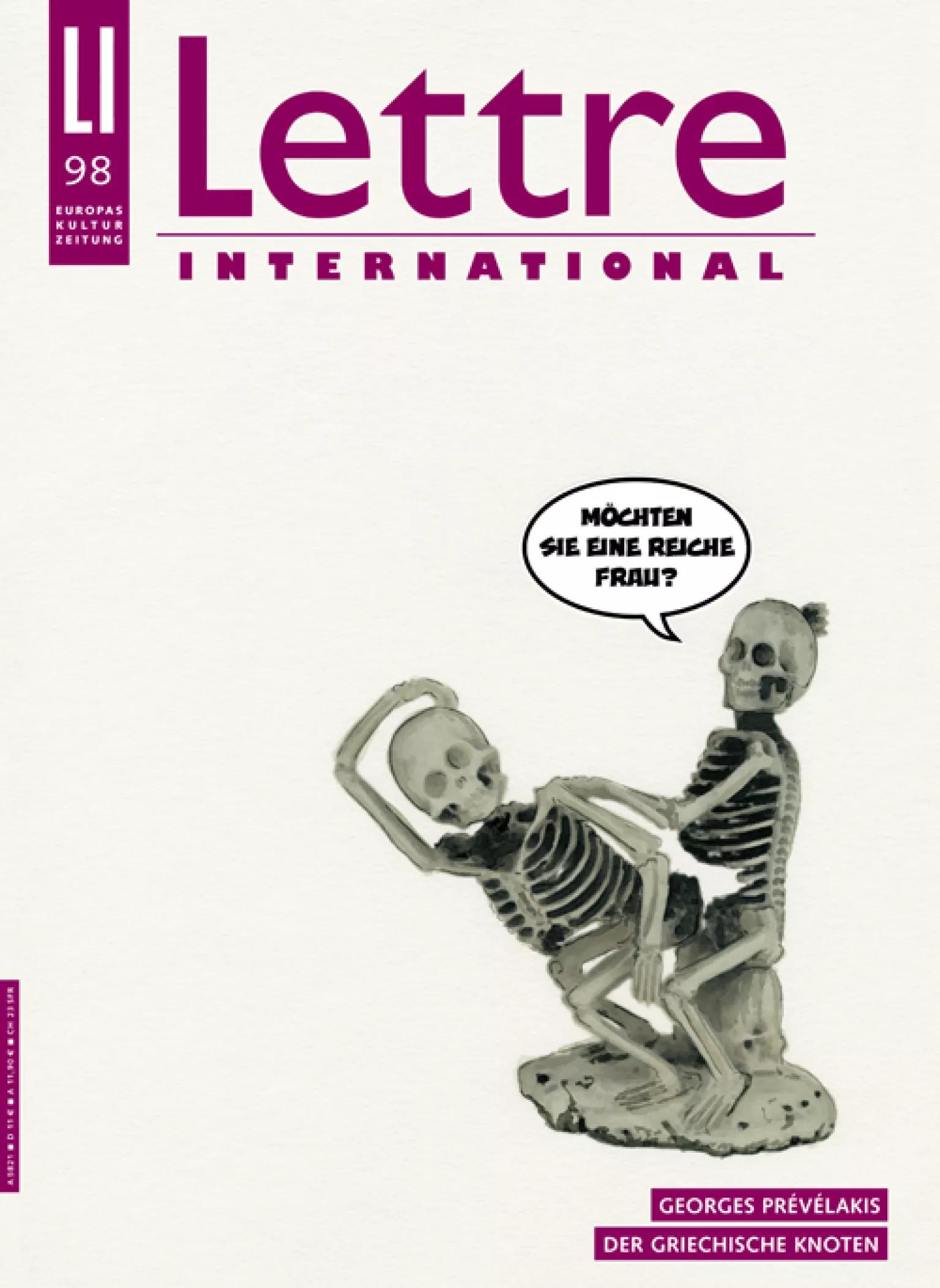LI 98, Herbst 2012
Mächte der Musik
Von der machtvollen Wirkung zum tiefgreifenden AnderswerdenElementardaten
Genre: Essay
Übersetzung: Aus dem Französischen von Markus Sedlaczek
Textauszug: 5.996 von 49.899 Zeichen
Textauszug
Auszug (5.996 von 49.899 Zeichen)
(...)
Keine Kunst vermag uns derart stark zu ergreifen wie die Musik, tief im Innersten des Subjekts wie auch inmitten der Menge, die sie organisiert und der sie gleichsam eine kollektive Seele und einen kollektiven Körper verschafft. Eben dieses Ergreifen und Ergriffenwerden möchte ich näher untersuchen, denn jenseits seiner anthropologischen und kulturellen Evidenz erweist es sich bei der Analyse als äußerst rätselhaft und verwirrend. Ein Satz von Adorno zielt mitten ins Herz des Problems: „… daß Musik zugleich die unvermittelte Kundgabe des Triebes und die Instanz zu dessen Sänftigung darstellt“. Die Musik ist eine wilde Macht (der „Trieb“), die immer schon zivilisiert wurde („Instanz zur Sänftigung“: „Besänftigen“ heißt weder „Zunichtemachen“ noch „Transponieren“, der Trieb ist in der besänftigenden Instanz stets lebendig). Die Musik scheint sich auf diese Weise sich selbst entgegenzusetzen, durchquert von einer Kraft, die sie gleichwohl beherrscht; Adorno spricht von der „zwiespältige(n) Erfahrung [mit der Musik], welche die Menschheit auf der Schwelle zum historischen Zeitalter machte“. Von dieser „zwiespältigen Erfahrung“ werde ich ausgehen, um aber immer wieder auf sie zurückzukommen, und zwar als der lebendigen Quelle dessen, was sich über die machtvoll ergreifende Wirkung der Musik bzw. das Ergriffenwerden durch Musik an Stichhaltigem sagen läßt.
(…)
Entfesselung, Besänftigung
Die Tatsache der machtvoll ergreifenden Wirkung von Musik ist evident, sie gibt aber auch Rätsel auf. Zwei Fragen werden klassischerweise in diesem Zusammenhang gestellt: Ist diese Wirkmacht der Musik physischer oder moralischer Natur (wie man im 18. Jahrhundert sagte), ist sie ein natürliches Phänomen oder ein kulturelles? Wie kommt es, daß diese Wirkmacht sich in zwei widersprüchlichen Formen äußert, sowohl als Entfesselung (die Mänaden, das Dionysische, die Verzauberung durch Pans Flötenspiel) wie auch als Besänftigung (das Lyraspiel des Orpheus, die apollinische Musik)? Und wie kommt es, daß sie sowohl Trance als auch ihr Gegenteil, die Ekstase, auslösen kann?
(…)
Alle Musikinstrumente können eine Trance auslösen, die Schlaginstrumente besitzen keinerlei Privileg (im Widerspruch zu unserer spontanen Intuition); Marianne Massin hat zum Beispiel eine präzise Untersuchung der orgiastischen Macht des Aulos in all seiner „Unheimlichkeit“ vorgelegt. Das große Klarinettensolo aus dem Quatuor pour la fin du temps von Olivier Messiaen mit seinen lang angehaltenen Tönen, verwirrenden rhythmischen Brüchen und bis zu kaum erträglichen Fortissimos ansteigenden Crescendos kann uns zumindest eine analoge Vorstellung von der machtvoll ergreifenden Wirkung des antiken Aulos geben.
(…)
Die ergreifende Macht der Musik wirkt sowohl regulierend als auch deregulierend, sie löst sowohl Bewegung aus als auch Reglosigkeit, sowohl Trance als auch Ekstase, sowohl den körperlich gedachten Tanz (Tanz ist auch eine cosa mentale) als auch die unkoordinierten Bewegungen eines Körpers, der sich ganz den Impulsen der Musik hingibt. Wie kann ein und dieselbe Ursache derart widersprüchliche und dennoch unbestreitbar belegte Wirkungen auslösen? Man wird zunächst denken, daß es nicht ein und dieselbe Musik sein kann, die diese widersprüchlichen Wirkungen auslöst. Ich bin da nicht so sicher. So ist etwa Beethovens Große Fuge für Streichquartett op. 133 ein typisches Beispiel für „absolute Musik“ (Musik, die von aller Referenz und aller außermusikalischen Bedeutung entbunden ist), mit einer Form (die Fuge), die nicht von der Tanzmusik abgeleitet ist, einem Thema (das Thema dieser Fuge), das eher streng ist; ein Werk, dem man, so scheint es, regungslos lauschen muß, indem man sein gesamtes Verstandes- wie auch Empfindungsvermögen konzentriert. Und dennoch: Wenn wir uns einmal von den Konventionen des Hörens frei machen, wenn wir bereit sind, die Energie dieser Musik zu transformieren, in Körperbewegungen umzuwandeln – dann läßt sie uns auch tanzen. Ein und dieselbe Musik wird also der Auslöser sein sowohl für pure Kontemplation als auch für ein Hingerissensein im Sinne von Marianne Massin sowie für einen Tanz, der seinerseits wohlorganisiert oder absolut entfesselt sein kann. Die machtvoll ergreifende Wirkung bzw. das Ergriffenwerden hängt also auch von der Antwort ab, die der Hörer auf den Vorschlag gibt, den das gespielte Werk ihm unterbreitet.
(...)
Selbst das allerbescheidenste musikalische Phänomen ist bereits mit nicht musikalischen Kräften besetzt. Gleichwohl ist es möglich und sogar notwendig, die Wirkmacht der Musik, ihr Vermögen, uns zu ergreifen [emprise], im kritischen Lichte einer Macht zu denken, die nur musikalisch wäre: das Anderswerden [altération]. Ein Anderswerden, das, wie bereits gesagt, als eine „Verfeinerung“ der ersten Wirkmacht der Musik betrachtet (gehört) werden kann – als Eroberung einer Wirkmacht anderer Art, die befreiend und nicht mehr entfremdend wäre.
(…)
Der „Wunsch nach Geräusch“ gehört in der Tat zum Menschsein: der Wunsch, Geräusche zu erzeugen, aber auch der Wunsch, Geräusche zu hören. (Dieser Wunsch nach Geräusch [bruit] steht übrigens keineswegs im Widerspruch zum Haß auf Lärm [bruit] – dem Lärm der anderen wohlgemerkt.) In gewisser Hinsicht ist die Musik der unmittelbare und völlig arglose Ausdruck dieses Wunsches: aus Leibeskräften zu singen; auf irgend etwas, das gerade zur Hand ist, einzuschlagen und es so als Schlaginstrument zu benutzen; der Wunsch, den Lautstärkeregler aufzudrehen, den Dezibelpegel ansteigen zu hören, an die Grenzen des Hörbaren zu gehen (nicht ohne reale Gefahren für das eigene Trommelfell: Musik kann gefährlich sein). Wir haben es hier mit dem Trieb des wilden Geräuschs zu tun, wenn dem Wunsch nach Geräusch allzu unmittelbar entsprochen wird.
Doch die Musik, als Instanz, die diesen Trieb besänftigt, wird den Wunsch transformieren: nicht annullieren (was unmöglich ist – und warum sollte man das tun?), sondern komplexer machen.
(...)