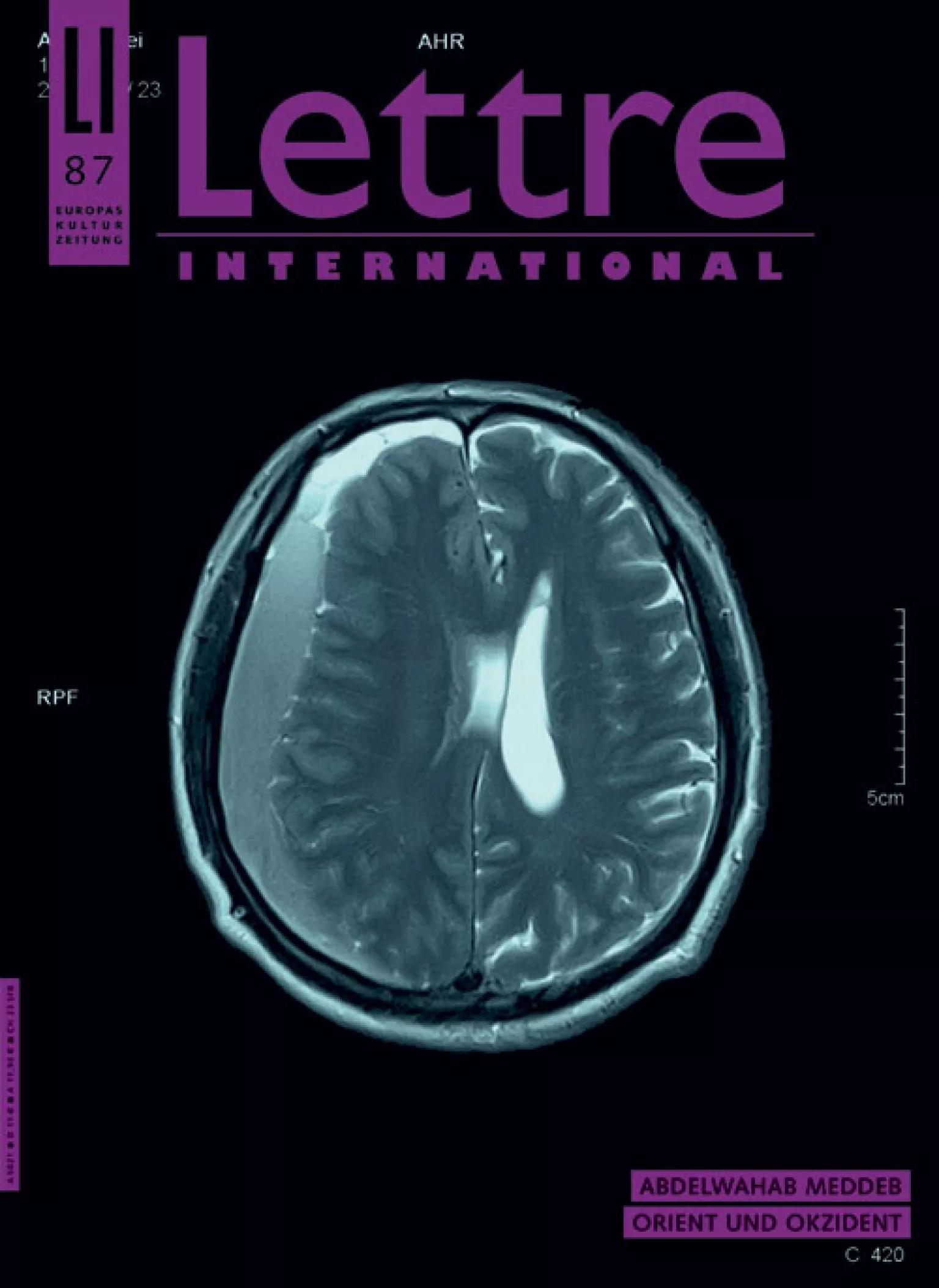LI 87, Winter 2009
Sprache und Emigration
Vom Überleben der deutschen Künstler in erzwungener FremdeElementardaten
Textauszug
Was bedeutet das eigentlich für den Schriftsteller: Emigration? Aus seiner Umwelt, aus seinem Publikum und seinem Verlag, aus seinem Sprachraum? „Wunderliches Erlebnis, daß einem, während man draußen ist, sein Land irgendwohin davonläuft, so daß man es nicht wieder finden kann“, notierte Thomas Mann schon 1933 ins Tagebuch. „Oh Ekel“, so Hilde Spiel: „Das Exil ist eine Krankheit.“ Und Albert Drach: „Ich bin gestorben, sie können jetzt nur mehr meinen Leichnam retten.“ Oder, laut meinem eigenen Lebensbericht Selbstbeschreibung: „Vielleicht ist es unmöglich, den Zauber einer Heimat zu erklären, weil er ja eins ist mit der nie zu definierenden Magie der Kindheit. In der Heimatliebe liebt man sich selbst daheim eingepflanzt im Rückblick. Darum führt Heimatverlust auch zum Abhandenkommen eines guten Stücks der normalen Selbstliebe, des voraussetzungslosen Zu-sich-selber-Stehens.“ Wie aber als Autor funktionieren, wenn man seine eigene Figur nicht mehr hat? Nicht weiß, wohin man gehört, das heißt letztlich, wer man ist. Identitätsverlust nennt sich so etwas. Als was schreibe ich? – das kommt noch vor: Für wen? oder: Wofür, wozu? Und damit innig verknüpft: In welcher Sprache? Dazu Peter Weiss: „Einmal lernte ein Kind, die Umwelt wieder erkennbar zu machen, indem jede Einzelheit sich messen und nennen ließ. Es lernte sich von einem bezeichneten Gegenstand zum andern zu bewegen, so entstand eine sinnvolle Orientierung. Jetzt aber verschwand das Nachprüfbare … Die Sprache lag ebenso entfernt, wie das Land, aus dem sie stammte. Indem man von der Möglichkeit des Benennens aller Vorgänge abgeschnitten war, war man auch von den Vorgängen selbst abgeschnitten.“ Ernst Bloch: „Man kann Sprache nicht zerstören, ohne in sich selber Kultur zu zerstören.“ Und Günther Anders: „Wie man sich ausdrückt, so wird man. Unterscheidungen, die wir als Sprechende nicht machen können, die spielen bald auch für uns als sinnliche und moralische Wesen keine Rolle mehr.“ Lauter Selbsterkenntnisse, ja Selbstbeschuldigungen, was sonst.
Denn dies ist nun das Herzzerbrechendste: „Wer allzu lange Pech hat, beginnt ja, sich schuldig zu fühlen“, hieß es in einem meiner Drehbücher zu dem dreiteiligen Emigrantenfilm Wohin und zurück. In einem versteckten Winkel seines Herzens sieht also der exilierte Schriftsteller keine Lebensberechtigung mehr für sich selber. Er, der nach außen hin das „bessere Deutschland“ repräsentiert, fühlt sich im Innersten als Deserteur, als Verräter an der Sprache und daher am Volk, das ihn verstieß. Und das Ausland, unser Retter, unser Gastgeber, war ja nicht selten der gleichen Meinung. Indem es, wie zum Beispiel die Schweiz, die Eindringlinge als bloße Wirtschaftskonkurrenz abtat für die Einheimischen. Siehe das Publikationsverbot für Robert Musil, das Singverbot für den unglücklichen Tenor Joseph Schmidt, den Druck der Fremdenpolizei auf Hochwälder und so viele andere. Bis hin zu dem Dramatiker Georg Kaiser, der geradezu in die pathologische Desorientierung getrieben wurde. Siehe auch das apodiktische Urteil des angesehenen Züricher Feuilletonredakteurs Eduard Korrodi, ausgewandert sei ja doch nur „die jüdische Romanindustrie“. Und wirklich: Die „Großen“ hatten sich drüben mehr oder weniger arrangiert: Hauptmann, Richard Strauss, Furtwängler, Gründgens, Albers, Jannings, Benn, Weinheber, Fallada, Jünger, sogar Kästner. Und wer waren wir dagegen? „Ich habe immer Angst, die eigene Sprache zu verlernen … Ich finde die Identität mit meinem Ich nicht mehr, nirgends hingehörig, nomadisch und dabei unfrei …“ So der erfolgreichste der emigrierten Schriftsteller, Stefan Zweig, drei Monate vor seinem Freitod.
Günther Anders seinerseits berichtet von der Angst, „daß mein Deutsch schon zu einer Art Privatlatein geworden“ sei. Und Peter Weiss: „Der aus seiner Sprache Verbannte konnte sie nicht mehr nach sich befragen. Er geriet in eine Freiheit, die grenzenlos war. Doch diese Freiheit war verwirrend. Nichts von dem, was er begonnen hatte, konnte fortgesetzt werden.“ Aber dazu kommt ja noch das Problem: Durfte man denn weiter dichten in der Sprache seiner Vertreiber, seiner Mörder? Und andererseits: Mußte man es nicht? Mußte man nicht die Sprache in die Pflicht nehmen auch dazu? Und wenn, dann wie? Welche Ausdrucksweisen wurden dem noch gerecht? Gab es überhaupt noch Worte, Entsprechungen, Metaphern für das, was in diesem Moment dort drüben vorging … und was man ohnehin lieber nicht nachvollzog und unausgefühlt ließ? Oder gab es bloß noch die „Asche ausgebrannter Sinngebung“ (Paul Celan)? Die „Scham der Kunst angesichts des der Sublimierung sich entziehenden Leids“ (Adorno)?
Konfrontiert mit alledem, entschieden sich, wie denn sonst, die meisten Schriftsteller – soweit sie es überhaupt noch waren – fürs Weitermachen, fürs Durchwursteln. Und zwar auf deutsch. Nur um schließlich in eine endgültige Zwickmühle zu geraten. Die Muttersprache (und warum sagt man eigentlich Vaterland, aber Muttersprache?), ist ja doch letztlich die Schöpfung des Landes, dem man einmal angehörte oder zu dem man dazuzugehören meinte. Wie das eine lieben und preisen ohne das andere? Wir Österreicher zum Beispiel wußten, daß die Volksabstimmung vom April 1938 keineswegs gefälscht zu werden brauchte, um Hitler gute neun Zehntel aller Stimmen einzutragen. Inklusive unserer Mitschüler, Freunde, Lieblingsdichter … und der Wiener Arbeiterkultur. Was blieb da noch zu lieben?
Es findet also eine unvermeidliche Trennung von Volk und Sprache statt. Die Sprache selbst wird zur Heimat! Man begeistert sich desto penetranter für die Sprache, je skeptischer man ihren neudeut-schen Vertretern gegenübersteht, die ihre Schönheit gar nicht richtig zu schätzen wissen. Und weiter: Je mehr die Sprache des Emigranten vom lebendigen Quell abgeschnitten ist, um so hingebungsvoller wird er sie vergötzen, ja sie künstlich zu verbrämen, aufzumotzen versuchen, um seine Herrschaft, seine Gewalt über sie zu erweisen. Aber genau das Gegenteil findet häufig statt: Die Sprache, deren man sich – anstatt ihr einfach zu dienen – allzu bewußt bedient, fängt mit der Zeit an, sich an ihrem Dompteur zu rächen. Sinkt gegen seinen Willen zu dem herab, was er ja gerade mit allen Mitteln zu vermeiden suchte: zum bloßen Kommunikationsmittler, zum Ideentransporteur. Sie verliert ihre Farbe, ihre Poesie, verblaßt, verdorrt, wirkt konstruiert und abstrakt. Sie „verblüht, ohne uns je ganz zu verlassen“ (Julia Kristeva). Dagegen anzukämpfen, gilt nun, statt seinem – ohnehin oft genug unnennbaren – Gegenstand, die Hauptenergie des Autors. Verzweifelt bohrt er nach Synonymen, gräbt in Wörterbüchern nach, ja muß er sich die Dinge schandbar aus der Sprache seiner neuen Umwelt in die alte rückübersetzen! Sprache ist ja doch mehr als ein „System von Zeichen, das einer Gemeinschaft als Verständigung dient“. Ist auch ein Netzwerk von Symbolen, von Assoziationen, von Sinnbildern aus einem gemeinsamen Erfahrungsschatz. Lebt man längere Zeit von seiner Sprache getrennt, so geht gerade diese Aura der Wörter, ihr Subtext verloren, ihre Sinnlichkeit. Ihre musikalischen, ihre olfaktorischen Eigenschaften verflüchtigen sich, sie stirbt ab. Dazu Günther Anders: „Während wir unser Französisch, Englisch oder Spanisch noch nicht gelernt hatten, begann unser Deutsch bereits Stück für Stück abzubröckeln, so heimlich und allmählich, daß wir den Verlust gar nicht bemerkten.“ Und Erich Fried: „Das Mischungsverhältnis von bewußten und unbewußten Faktoren beim Schreiben geht auf frühkindliche Erfahrungen, auch Erfahrungen beim Sprechenlernen zurück … Härter als viele andere traf daher das Flüchtlingsdasein uns, deren Lebenssphäre die Sprache war.“ Noch schärfer Nancy Huston: „Man hat ein Unbewußtes nur in seiner Muttersprache.“ Und fast mit den gleichen Worten Ernst Bloch: „Was nach dem achten Lebensjahr kommt, wird kaum mehr dichterisch-irrational, sondern nur noch als rationale Problemstellung verarbeitet.“
(...)