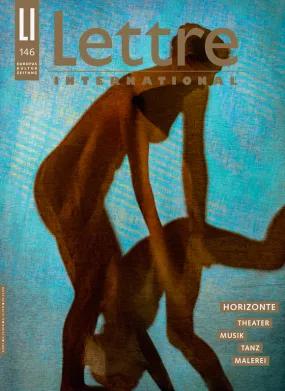LI 108, Frühjahr 2015
Mikrokosmos Mosfilm
Das Jahr 1937 – Künstler und Macht, Kreativität und Großer TerrorElementardaten
Genre: Essay
Übersetzung: 7.268 von 44.081 Zeichen
Textauszug: Aus dem Russischen von Sergej Gladkich und Hans Günther
Textauszug
(…)
Als Vergrößerungsglas nehmen wir das Jahr 1937. Erstens war es ein Jubiläumsjahr: Der zwanzigste Jahrestag der Revolution stand ins Haus. Folglich erwartete man „bedeutende“ Werke von der Kunst. Das Studio befand sich indes in der Klemme. Für die Filmgeschichte spielen die Unterschiede zwischen den Studios keine große Rolle, für die Obrigkeit hingegen schon, und Mosfilm mußte sich also dringend rehabilitieren. Zweitens war 1937 das Jahr des Großen Terrors, und der Film war kein Schonrevier. Überdies verlief die Geschichte des Studios auf der Grenze zwischen dem, was jenseits der Leinwand geschah, und dem, was auf der Leinwand übrig blieb. Spätere Legenden erzeugen häufig ein gravierend anderes Bild von Filmen als deren Schicksal in den Studios tatsächlich aussah. Und drittens war das Jahr 1937 reich an Versprechungen und karg an deren Einlösung.
Zur Kenntnisnahme: 1937 hatte Mosfilm zwanzig sowjetische Regisseure, dazu zwei Deutsche, Hans Rodenberg und Gustav von Wangenheim, die auf irgendeine Weise „neutralisiert“ werden mußten, denn für deutsche Filme gab es kein Publikum. Geplant waren zwölf Spielfilme, Animationsfilme nicht mitgerechnet. Das Durchschnittsbudget pro Film betrug 1 400 Rubel. So sah es auf der „Input“-Seite aus; auf der des „Outputs“ war alles ganz anders. Ich möchte nur auf drei dieser Filme eingehen, von denen jeder sein eigenes „Schicksal“ hatte: einer mit einem „schlimmen“, ein zweiter mit einem „guten“, ein dritter mit einem „aufgeschobenen“ Ende.
Die Beschinwiese
Die physische Vernichtung des Films Die Beschinwiese von Sergei Eisenstein ist ein derart prominenter Fall in der Filmgeschichte, daß er eigentlich keiner Erläuterung bedarf. Bekannt ist auch die persönliche Feindschaft zwischen Boris Schumjazki, dem damaligen Chef der Hauptverwaltung Film (HVF), und Eisenstein. Dennoch läßt sich das Mosfilm des Jahres 1937 ohne die Zerstörung von Die Beschinwiese unmöglich darstellen.
(…)
Das Verbot der Beschinwiese darf man jedoch nur zu einem geringen Teil als Resultat einer Laune des Chefs der HVF ansehen: Es war die Folge einer „systemischen“ Anordnung, wenn man sich an alle sonstigen Verbote erinnert, die damals wie ein Sperrfeuer über alle Truppenteile der Künste niederprasselten. Es war der gesetzmäßige Teil einer allgemeinen Kampagne der Bekämpfung des „Formalismus“ (plus „Naturalismus“). Aber unser Thema ist Mosfilm, und durch das Zielvisier dieses Kampfes kann man einige der ablaufenden Prozesse gewissermaßen in der Totale beobachten.
Wie immer sich die Geschichte innerhalb des Studios abgespielt hat, das kompromißlose Verbot von Die Beschinwiese am 5. März 1937 ging vom Politbüro aus. Das Original dieses Verbots wurde auf einen Fetzen Papier gekritzelt: „1. Diese Produktion ist aufgrund der antikünstlerischen Haltung und krassen politischen Haltlosigkeit des Films zu verbieten. (…) 4. Gen. Schumjazki wird verpflichtet, diesen Beschluß den künstlerischen Mitarbeitern des Filmwesens zu erläutern.“ Im weiteren ging es um administrative Sanktionen gegenüber der Studioleitung.
Eine direkte Umsetzung des Politbüro-Auftrags stellte die „Beratung des künstlerischen Aktivs zu Fragen des Verbots“ bei Schumjazki vom 19. bis 21. März dar, die einen Einblick in die „Küche“ von Mosfilm gewährt. Den „schöpferischen Alltag“ hat man sich in etwa so vorzustellen: Die Regiegilde – einstweilen noch unbehelligt – war nicht nur zersplittert, sondern teilte sich in diejenigen auf, die „für das Studio“, und solche, die „für die Hauptverwaltung Film“ waren. Wie üblich im Intellektuellenmilieu wurde jeder, der mit der Auffassung der Beamten einverstanden war, als „Liebediener“ und „Speichellecker“ geschmäht. Das ging so weit, daß das Erscheinen eines guten Films als Unterstützung Schumjazkis hingestellt werden konnte. Die Regisseure hatten ihre Vorstellung von künstlerischer Unabhängigkeit noch nicht ganz verloren, und selbst Sergei Eisenstein, als „Meister“ und treuer Sohn des Sowjetstaates im Ausland, meinte, sein Filmmaterial jedem zeigen und dem leidenschaftlichen Urteil eines Wsewolod Wischnewski oder eines Lion Feuchtwanger vertrauen zu können. (Doch selbstverständlich wurde alles der Obrigkeit zugetragen.) Einerseits erinnert dies alles an die Zustände in einer „Kommunalwohnung“, an ein „Rabennest“; zum anderen demonstriert es ein weiteres Mal die Tatsache, daß Gleichschaltungsversuche in Rußland immer nur eine regulative Utopie darstellen und nicht mehr.
Was den Film anbelangt, so ließ die schroffe Vorgabe des Politbüros keinen Raum mehr für eine Diskussion über die Wege der Kunst, die noch zwei Jahre zuvor möglich gewesen war. Diesmal handelte es sich nicht um die Ermordung eines jungen Pioniers, sondern um die eines Films. Dabei war Die Beschinwiese für das Studio das teuerste und ambitionierteste Projekt des Jubiläumsjahres. Die Diskussionsteilnehmer begannen zu verstehen, daß es hier nicht um eine von vielen kulturpolitischen Maßnahmen, sondern um etwas Ernsthafteres ging. Und daß sie sich, wie man sagt, „festlegen“ mußten.
Sergei Eisenstein, der Revolutionär par excellence, „bereute“ in der Terminologie des „Individualismus“, welche in der vorangegangenen Epoche das gesamte Feld des Problems „Intelligenzija und Revolution“ dominiert hatte. Man hätte sie für veraltet halten können, wenn man nicht auch zu Zeiten des „Tauwetters“ Jungpioniere und Komsomolzen in demselben Sinn umzuerziehen versucht hätte. „Ich fühlte mich wie ein Don Quijote, wie jemand, der auf seine eigene Weise in die Revolution eintritt. Und dies ist mein Hauptfehler: Mir wollte es immer scheinen, ich hätte in ideologischen und künstlerischen Fragen das Recht auf eigene Meinung.“ Möglicherweise hatte der Meister nach seiner Rückkehr aus Amerika nicht gleich verstanden, daß er in ein anderes Land zurückgekehrt war. Über dem Leichnam des erschlagenen Films formulierte er illusionslos die aufgegebene Lektion wie folgt: „Aufgabe des Künstlers ist es nicht, auf eigene Weise zu interpretieren, sondern, die Meinung und die Beschlüsse der Partei zu verwirklichen.“
Unter den Regisseuren hatte Eisenstein einen prinzipiellen Gegner: M. Marjan, dessen Einwände systemischen Charakter hatten, da sie von einer ganz anderen Filmkonzeption ausgingen (wie seinerzeit die Sergei Jutkewitschs) und offenbar aufrichtig gemeint waren. Zwei andere Regisseure jedoch verteidigten entschlossen Eisenstein, freilich unter Beachtung des Rituals. Barnets Rede war kurz, aber unzweideutig: „… damit Sergei Michailowitsch seine Fehler erkennt, müßte man ihm die Möglichkeit geben, das Material so zu schneiden …, wie er es ursprünglich wollte. Ich glaube an einen so großen Künstler wie Eisenstein.“ Michail Romm, der Eisenstein vergötterte, lenkte das Feuer auf sich: „… wir müssen auch unsere Gesichter diesen Schlägen hinhalten … in dieser gemeinsamen Fabrikangelegenheit, sind wir doch Regisseure dieser Filmfabrik und haben uns als der letzte Dreck erwiesen.“ Er begriff die Geschehnisse genauer als die anderen und nahm sie nicht nur zur Kenntnis, sondern formulierte auch für sich die „organisatorischen Schlußfolgerungen“.
Doch es blieb nicht beim Ritual der Geißelung. Wie man den Archiven Platon Kerschenzews entnehmen konnte, stand Eisenstein kurz vor dem „Berufsverbot“, wenn nicht Schlimmerem.
(…)