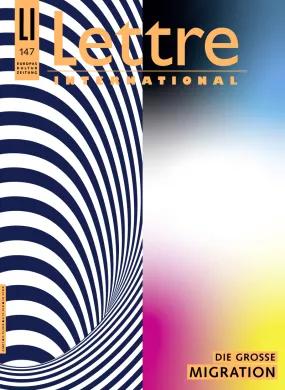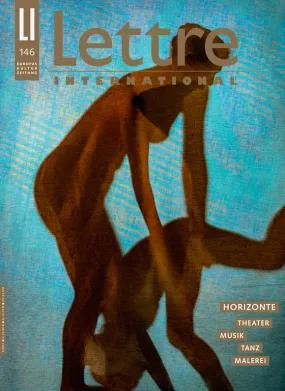LI 89, Sommer 2010
Marktkunst
Über eine Zeitgenössische Erscheinungsweise des ErhabenenElementardaten
Textauszug
Auf kaum etwas ist im Kunstbetrieb mehr Verlaß als auf marktkritische Bemerkungen. Schon seit der Romantik ist es Standard, die Sorge zu formulieren, die Kunst könne durch kommerzielle Interessen, durch warenökonomische Mechanismen, durch den Pragmatismus einer Handelsbeziehung Schaden nehmen. So wird befürchtet, daß auf dem Markt nur Erfolg hat, was auch einer Mehrheit gefällt – was also konventionell und harmlos, vielleicht sogar trivial und kitschig ist, während das Neue, Ungewohnte – und daher zuerst Befremdende – nur wenig Resonanz findet. Kaufen die meisten denn nicht nur das, was sie schon kennen? Und ist der Markt damit nicht eine konservative Instanz, die der Weiterentwicklung der Kunst schadet? Die vor allem dem Anspruch zuwiderläuft, wonach sich Kunst durch Originalität – durch Distanz von bereits vorhandenen, etablierten Werken – auszuzeichnen hat? Ist der Markt also nicht der Gegner der Kunst?
Von zahllosen marktfeindlichen Autoren sei ein einziger als Beleg zitiert. Martin Heidegger schreibt 1946: „Das Menschliche des Menschen und das Dinghafte der Dinge löst sich innerhalb des sich durch-setzenden Herstellens in den gerechneten Marktwert eines Marktes auf...“ Will sagen: Die Intensität, die einem Kunstwerk eigen sein kann, weil es von einem erfahrungsfähigen Menschen gemacht und eigens gestaltet ist, geht verloren, wenn es von vornherein darauf angelegt ist, sich auf einem Markt bewähren zu müssen. Dann gerät es in den Sog der Nachfrage und ist autonom – originell, ursprünglich – nicht mehr möglich.
Doch kann man die Zusammenhänge nicht auch anders sehen? Läßt sich nicht einfach die Gegenthese aufstellen? Als Frage formuliert hätte sie dann folgendermaßen zu lauten: Könnte es nicht sein, daß Kunst den Markt braucht, um als solche überhaupt wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden, ja um, wie es Walter Grasskamp einmal formulierte, „ihre Sichtbarkeit“ zu gewinnen? Kommt die Kunst sogar nicht erst durch den Marktwert eines Marktes als etwas Besonderes – zum Teil auch als etwas Befremdendes, „Anderes“ – zur Geltung? Ist es also nicht gerade der Markt, der die Kunst – gerade große Kunst – überhaupt erst macht?
Bekanntlich sind die Preise auf dem Kunstmarkt zuletzt so stark gestiegen, daß fortwährend Rekorde gebrochen wurden: das teuerste Gemälde, das teuerste Werk eines noch lebenden Künstlers, die teuerste Photographie. Meist wurden diese Rekorde bei Auktionen erzielt, und die spektakulär versteigerten Werke schafften es bis in die Abendnachrichten sowie auf die Titelseiten der großen Zeitungen. Namen wie Pablo Picasso, Jackson Pollock und Mark Rothko assoziiert das interessierte Publikum mittlerweile mit zwei, gar dreistelligen Millionenbeträgen. Und 2008, kurz vor Beginn der Finanzkrise, gab es bereits die ersten, die spekulierten, ob und wann das erste Mal die Milliardengrenze für ein Kunstwerk überschritten würde.
Was aber bedeutet es, wenn Kunst so stark über die Preise codiert wird? Wie verändert das Wissen um das viele Geld, das hier im Spiel ist, die Wahrnehmung? Die Betrachter versuchen, den hohen Preis im Kunstwerk als besonderen Wert zu erkennen – in ihm das viele Geld als Kunst wiederzufinden. Sie wollen sehen, worin sich etwas so Teures von anderem unterscheidet. So wird genauer als sonst geschaut, ja geradezu detektivisch gemustert: Wo ist eine besondere Faktur oder eigentümliche Materialität? Und muß nicht viel größerer Aufwand, höhere Intensität, stärkere Brillanz, klarere Präsenz als bei Preiswerterem zu bemerken sein? Der Preis fungiert also als Wertpostulat; er suggeriert, daß es sich bei dem Werk um große Kunst handeln muß. Der britische Installations- und Konzeptkünstler Jeremy Deller bekannte, er sehe am Preis, ob etwas Kunst sei. Nur ein guter Preis garantiert also Wertschätzung. Damit aber kann der Preis sogar konstitutiv für das Werk als Kunst sein.
Bereits in den fünfziger Jahren dachten die ersten Künstler darüber nach, wie der Preis Wahrnehmung und Wert eines Werks beeinflußt, ja ob es nicht sogar möglich sei, ihn eigens zum Gegenstand künstlerischen Tuns zu machen. So berichtet Yves Klein von einer Ausstellung, bei der er 1957 in einer Mailänder Galerie elf monochrome blaue Gemälde zeigte, die alle dasselbe Format und dieselbe Faktur besaßen. Doch der Preis sei „selbstverständlich“ bei jedem Bild ein anderer gewesen („Les prix étaient tous diffé-rents bien sûr“), habe sein Ziel doch darin bestanden, klarzumachen, daß die bildnerische Kraft eines Kunstwerks nicht an seinem materiellen Erscheinungsbild zu erkennen sei. („La qualité picturale de chaque tableau était perceptible par autre chose que l’apparence matérielle …“) Zwar ist die Behauptung, die Bilder hätten unterschiedlich viel gekostet, vermutlich nur eine von Klein in die Welt gesetzte Legende, doch beweist seine Äußerung ein frühes Interesse daran, Kunst mit Hilfe ihres Preises zu machen. Dabei gilt: Je teurer das Bild ist, desto besser ist es – desto mehr Wert und Bedeutung verheißt es zu haben.
Im Wissen um den Zusammenhang zwischen Preis und Wertzuschreibung versuchte die Fluxusbewegung in den sechziger Jahren, ein gegenläufiges Konzept zu entwickeln. Da man danach strebte, Kunst zu einem möglichst unspektakulären, alltäglichen Gebrauchsgut zu machen, entwickelte man Multiples, die preiswert, wie Produkte eines Supermarkts, vertrieben wurden. So wie hohe Preise die sakrale Aufladung der Kunst begünstigten, sollten also umgekehrt niedrige Preise zu einer Profanisierung beitragen. Der Wert der Kunst, so George Maciunas, „muß gesenkt werden“, indem man sie „unbegrenzt verfügbar macht“. Auch der moderne Kunstmessenboom entsprang in den sechziger Jahren der Idee, Kunst zu einem unprätentiösen Massenprodukt werden zu lassen, das allen zugänglich ist und nicht länger durch hohe Preise einschüchtert und befremdet. So wurde der Kölner Kunstmarkt 1967 vornehmlich von links gesinnten Galeristen ins Leben gerufen, und es mutet als Paradoxon an, daß davon ausgehend Kunstmessen innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem Ort wurden, an dem es vor allem darum geht, mit teurer Kunst Mächtige und Prominente anzuziehen. Spätestens mit Gründung der Art Basel Miami Beach im Jahr 2004 sind Kunstmessen zum Inbegriff eines elitären Kunstspektakels geworden. Wer es als Künstler hierher geschafft hat, darf sich als Star fühlen, dessen Werke besondere Bedeutung verheißen.
Bevor sich die hot spots des Kunstmarkts ausbildeten, waren es die Urteile von Autoritäten des Kunstbetriebs und vor allem Institutionen wie Museen und der sogenannte white cube, der aseptische, leere Ausstellungsraum, von denen solche Verheißungen ausgingen und die damit das „machten“, was dann allgemein als Kunst galt. So wird auch das in einem white cube Präsentierte mit mehr Aufmerksamkeit und Respekt bedacht – allein weil es in ihm auftaucht. Vieles aus der modernen und zeitgenössischen Kunst wäre sogar ohne die Institution des white cube überhaupt nicht denkbar, ließen sich doch etwa Ready-mades nicht von den Alltagsgegenständen unterscheiden, die sie sonst sind. Allerdings ist das breitere Publikum in solchen Fällen genauso wie bei einem überraschend hohen Marktpreis verlegen, da es zwar anerkennt, es mit Kunst zu tun zu haben, diese auch zu erspüren oder zu erfassen sucht, sie aber letztlich nicht erkennen kann.
Bei allen Parallelen zwischen dem white cube und den Marktpreisen stellt sich der behauptete besondere Wert eines Werks jedoch in beiden Fällen unterschiedlich dar. Im Museum wird es zum Exponat: Es ist freigestellt, alltäglicher Bezüge entkleidet und damit auch verfremdet. Statt das Werk, wie andere Dinge auch, in lebensweltlichen Zusammenhängen wahrzunehmen, sieht man es isoliert. Zwar ist ihm deshalb alleinige Aufmerksamkeit garantiert, doch daß in seiner Verfremdung nur wenige zusätzliche Anhaltspunkte gegeben sind, um das Werk zu verstehen, läßt es unerschließbar werden. Indem es also im white cube rätselhaft wirkt, wird ihm erst besondere Bedeutsamkeit verliehen.
Dagegen schafft ein Preis Bezüge: Das damit Ausgezeichnete ist in der universalen Sprache des Geldes taxiert und steht so in Relation zu allem, was ebenfalls einen Preis hat. Das ist auch ein Grund, warum viele sich dagegen wehren, Kunstwerke überhaupt als Waren – als etwas mit einem bestimmten Preis – anzusehen. Ihrem Begriff von Kunst entspricht es nämlich, daß sie etwas radikal anderes ist als alles andere – unvergleichlich und eine absolute Ausnahme, so wenig mit üblichen Maßstäben zu messen wie ein Gott. Daher auch die Singularisierung, die Exponierung der Werke im white cube. Auf dem Markt hingegen droht ein Werk, das eine vier- oder fünfstellige Summe kostet, immer noch mit zu vielem Alltäglichen – einem Auto, einem Wellnessurlaub – auf einer Stufe zu stehen. Erst ein sehr teures Werk tritt in Distanz zu alltäglichen Gütern und erscheint bedeutsamer, doch steht auch es noch in Beziehung zu anderem, das seinerseits sehr viel kostet. Tobias Meyer, der Chefauktionator von Sotheby’s, weist darauf hin, daß es selbst für ein vermeintlich spektakulär teures Gemälde noch etwas Vergleichbares gibt, nämlich etwa eine Eigentumswohnung in Bestlage in New York, die durchaus 30 Millionen Dollar kosten kann. Nur die wenigen Werke, die Rekorde erzielen und sich der 100-Millionen-Grenze nähern, bilden nochmals eine Klasse für sich; ihnen gegenüber erscheint selbst das, was zum aufwendigsten Lifestyle gehört, also sogar eine Yacht, ein Privatflugzeug oder eine Insel vor Dubai, als relativ billig und bieder. Nur sie werden durch den Markt genauso exponiert wie sonst im white cube.
(...)