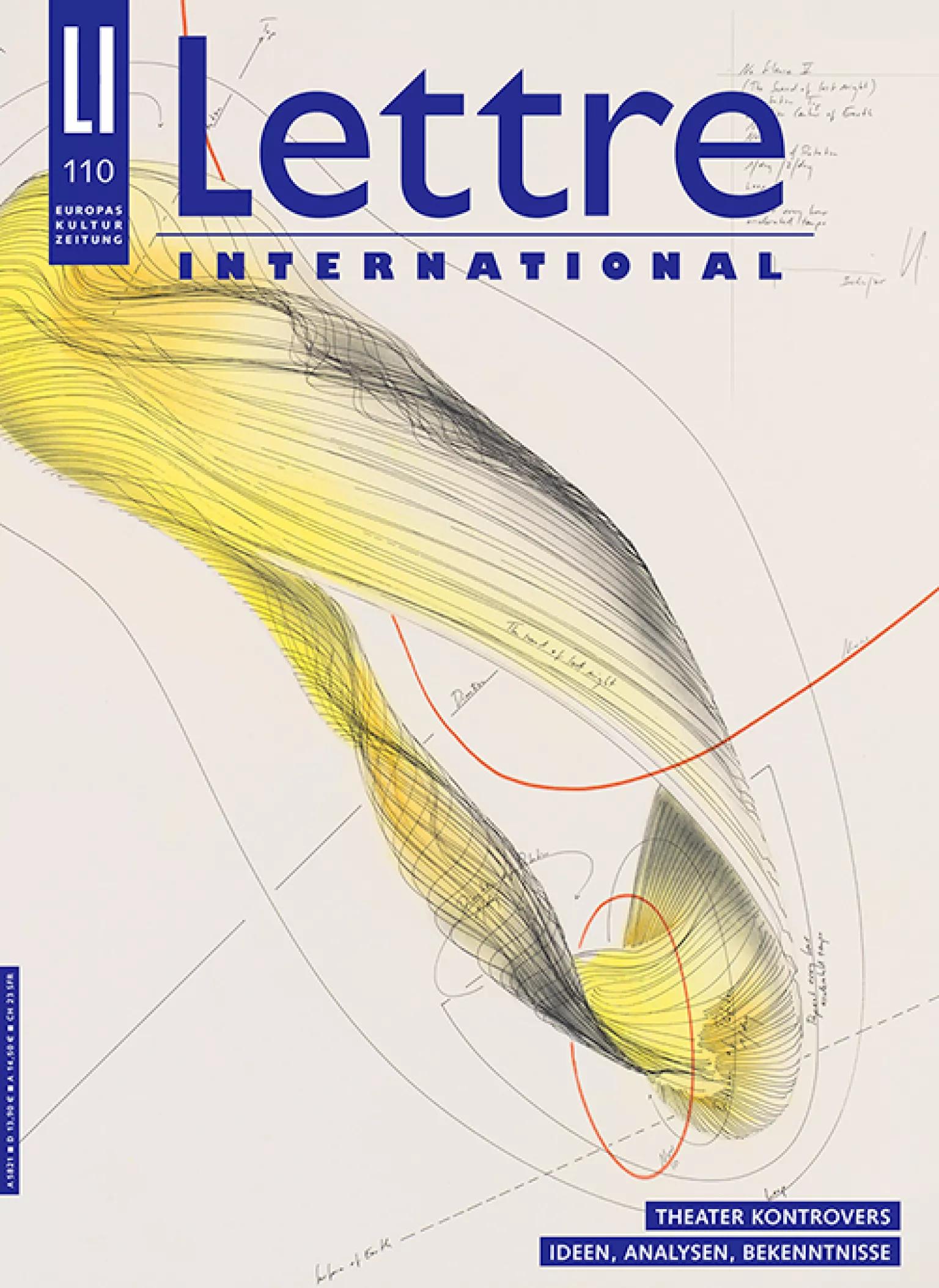LI 110, Herbst 2015
Leben! Benutz mich!
Deutscher Theaterpreis 2015! Die Schauspielerin in einem intensiven DialogElementardaten
Genre: Gespräch / Interview
Textauszug: 9.528 von 56.147 Zeichen
Textauszug
(...)
Frank M. Raddatz: Nun ist die Bühne ja der Ort, wo man spielend auch Extremes durchbuchstabieren kann, ohne daß die Seele Schaden nimmt.
Bibiana Beglau: Wenn wir ein Liebespaar wären und ich sage: „Ich benutze dich jetzt!“, dann hängt doch sofort der Haussegen schief. Oder ich sage: „Benutz mich!“ Dann heißt es sofort: „Wie soll ich dich denn benutzen? Als Klopapier, Zeitung, als Abwaschschwämmchen oder was?“ „Benutz mich!“, das kann man doch nur in der Sado-Maso-Szene sagen. Aber das meine ich nicht. Das Leben benutzt uns. Es schleift uns und wir schleifen das Leben. Und im Leben finden die eigentlichen Spiele statt. Als hartes Spiel zwischen Erwachsenen. Ich spiele, bis deine Ohren ab sind, bis du zum van Gogh wirst und ein Ersatzohr brauchst. Deshalb braucht es einen guten Orientierungssinn. Gerade wenn sich jemand wie ich permanent verläuft oder auf Menschen trifft, die einen dazu bringen, sich zu verlaufen. Man braucht viel Kraft, um gerade demjenigen, der einem das größte Mißtrauen entgegenbringt, Vertrauen zu injizieren, damit er einen nicht in eine Irre führt, aus der man nicht wieder rauskommt. Man muß sich Leute suchen, die stärker sind als man selbst, Leute auf Augenhöhe, die einen zersplittern lassen. Wenn ich sage, daß ich im Leben spielen will, dann meine ich das Kindliche, nicht das Infantile dieser Spiele. Wenn man vom Schauspiel sprechen würde, was ich nicht möchte, weil ich das nicht interessant finde, müßte es darum gehen.
Ich halte nichts von dieser Beständigkeit, nach der sich viele Schauspieler sehnen. Angefangen beim Festengagement. Ich empfinde das Leben als langweilig und gleichzeitig als extrem anstrengend. Ich wollte als Kind schon nicht so lange leben, aber es ist mir nicht gelungen, früh zu sterben. Jetzt lebe ich manchmal in dem Wahn, uralt zu werden, und sehe in dieser Gesellschaft vollkommene Teilnahmslosigkeit, wie mal hier etwas repariert wird, dort eine Stellschraube nachgezogen wird. Anstatt Vorkehrungen zu treffen, daß wir ein qualitativ möglichst hochwertiges Wurmfutter werden, kreist unser ganzes Leben um den Reparaturbetrieb, der uns die Vergänglichkeit vom Leib hält. Ich plädiere jetzt nicht für den großen Wahnsinn, sondern möchte, daß die Bühne dem Denken andere Möglichkeiten eröffnet.
Spielen als etwas Existentielles. Der spanische Maler Ramón Gaya notiert in einem Essay über Velazquez, daß das Leben nicht für uns da ist. „Im Gegenteil: Wir sind für das Leben da. Wir begegnen ihm allein, um es zu würdigen.“
Ich meine nicht die große Party, sondern die Essenz. Trotz des Wissens um Vergänglichkeit mußt du die Hingabe und das Durchhaltevermögen haben. Daran hat sich in all den Jahrhunderten nichts geändert. Das Tolle ist, daß der Mensch so eine robuste Ratte ist, trotz aller Deckelungen und Ordnungssysteme, auch den demokratisch selbstgewählten, die ihn von seinem Chaos abbringen sollen.
Einfach nur spielen, das ist dann für die Sandkiste. Deswegen halte ich nichts vom Beruf Schauspieler. Das ist kein Beruf, den ich ernst nehmen kann. Mich zu verstellen und so tun als ob finde ich bescheuert. Wenn es aber um mehr geht, begreife ich das als eine Herausforderung, als ein selbstpropagandistisches Moment, und dann entsteht möglicherweise Kunst. Viel aufregender ist, Leben zu fressen und vom Leben gefressen zu werden.
(…)
Ein Theater, das Angst vorm Extrem hat, verfehlt sich.
Erst durch die Lust am Extrem werden alle Zwischentöne wieder möglich: Der Schrei vom Geburtskanal bis in den Sarg hört nicht auf, und ohne diese Extreme bekommt man die Null-Linie und die Palette der Zwischentöne nicht. Das ist in der Photographie dasselbe. Wer jemals ein Schwarz-Weiß-Photo abgezogen hat, der weiß, was es heißt, Grautöne zu erzeugen. Peter Handke übersetzt das in Realgeschichte. Er wünscht sich ein vielsprachiges Europa mit vielen Facetten und will das Babylonische, Kleine, Verschiedene, eben die Grautöne erhalten: ein Biotop für die letzten Indianer, die sich an ihren Sprachgrenzen zuwinken.
Diese Zivilisation beruht aber auf der Dualität von eins und null. Mit der Aufspaltung ins Duale beginnt, wie Ernst Jünger in seinem Aufsatz Zahlen und Götter sagt, alles Übel. Jetzt haben wir all diese Ordnungssysteme, die alles aufrastern in Schwarz oder Weiß, in null oder eins, aber die Zwischentöne, das Chaos, was dem Menschen eigentlich so naheliegt, darf nicht mehr sein. Vor dem Chaos haben wir Schiß, dabei unterliegen wir dem Chaos der Natur. Doch haben wir Systeme geschaffen, um uns zu ordnen, zu beherrschen, zu entwickeln.
In Wahrheit besteht das Leben aus Fleisch, Blut und Knochen und einer Mühle, die ständig weiter mahlt. Trotzdem lacht man, man lacht sich zu Tode in der Komödie, man weint sich zu Tode im Drama. Es ist immer auch ein Tanz des Lebens und des Todes. Das vergessen wir, wenn wir meinen, daß Theater ein korrekter oder ein kluger Ort sein sollte.
(…)
Wie soll der Schauspieler auf der Bühne eine radikale Autonomie herstellen, wenn er nur ein Rädchen ist oder Objekt eines Regietyrannen?
Dieses Verhältnis zwischen der Tyrannei des Regisseurs und der Freiheit des Schauspielers kann man auch umdrehen: die Tyrannei des Schauspielers und die Freiheit des Regisseurs, und fragen, wie bedingen sich solche Systeme gegenseitig?
Viel schlimmer noch ist der Devotismus im Theater, wo man sagt: „Wir sind so heilig in unserer Kunst, daß jeder, der quasi nicht auf der Bühne das Wort ergreift oder nicht vor dem Abend niederkniet, rückwärts wegkriechen muß und einem nicht in die Augen schauen darf.“ Der schlimmste Fall tritt ein, wenn die Regie sagt: „Das ist ein ganz toller Schauspieler, der hat dem Kollegen den Schuh an den Kopf geschlagen, das macht nur ein ganz Großer!“ Was ist denn das für eine Einstellung? Jemand schließt sich drei Stunden in der Garderobe ein und läßt alle warten, weil er gerade indisponiert ist, und das wird als künstlerische Qualitätsauszeichnung gewertet? Das Aushängeschild der Diva besteht darin, daß sie vollkommen ausflippt. Menschlich auf dem Niveau eines dreijährigen Kindes, das sich auf einen Steinpflasterboden schmeißt und mit den Händen trommelt. Das zeichnet Diventum aus? Ich finde es infantil, wenn man andere Leute kriechen läßt, damit es einem selber besser geht.
Beliebt ist auch, sich auf die eigene Angst zu berufen und damit rauszureden: „Ich war Arschloch, weil ich Angst hatte“, und dabei kann man sich nicht mal vor das Ensemble stellen und sich richtig entschuldigen. Man darf sich nicht mit solchen Verhältnissen arrangieren. Solche Verhältnisse müssen sich im Namen der Eigenverantwortlichkeit ändern. Oder man gibt vor der Fassade der heiligen Bühnenkunst ein divenhaftes Blablabla von sich und stellt sich selbst als Moment eines größeren Zusammenhangs, eines sinntriefenden Gesamtkonstrukts dar, so daß man schlußendlich besser als die Welt erscheint und als alles, was sie zusammenhält. Und weil das so ist, müssen die anderen kriechen. Ob man dieses Divengehabe will, kann und muß man selbst entscheiden. Selbst wenn Regisseure der Meinung sind, der verehrte Schauspieler oder die verehrte Schauspielerin sei heilig und alles um sie herum müsse kriechen, sonst könne er oder sie sich nicht konzentrieren, bleibt einem die Eigenverantwortlichkeit zu entscheiden, ob man das mitmacht.
Im Film ist es übrigens absolut dasselbe Spiel. Der Schauspieler unterscheidet sich nicht von der restlichen Welt. Manche produzieren heiße Luft, um als Vorkommnis zu wirken; andere bestechen durch ihre Arbeit. Allerdings müßte das in einem Bereich wie der Schauspielerei genauer durchdacht werden, weil man permanent mit Literatur und Konzepten umgeht, die eben dies zum Thema haben.
Man kann in der Arbeit total Arschloch sein. Dagegen habe ich nichts. Es ist mir fast lieber, wenn jemand sagt: „Diese Arbeit ist kein Spaß“, aber trotzdem sensibel dafür ist, wenn es dem anderen dreckig geht. Man muß den Anspruch haben wahrzunehmen, wie es dem Gegenüber geht. Man darf auch nicht wie in einer völlig abgestumpften Familie alles hinnehmen, sondern muß, wenn nötig, Verantwortung übernehmen und sagen: „Ich bin weiterhin Arschloch zu dir, aber ich weiß, wie es dir geht und ich passe jenseits des künstlerischen Raums menschlich auf dich auf!“ Unter den Schauspielern gibt es Hackordnungen, und trotzdem muß jeder Sorge dafür tragen, sich um den andern kümmern zu können und in der Lage zu sein zu sagen: „Hier stimmt doch was nicht? Was ist denn eigentlich los?“ An solcher Eigenverantwortlichkeit mangelt es. Wenn du siehst, daß jemand nicht nur an der Arbeit leidet, sondern noch an anderem, muß die Sorgfalt walten. Komischerweise geschieht das selten. Aber ich habe auch bei den ganz Großen erlebt, daß sie vielleicht nichts sagen, aber auf einen aufpassen. Von anderen Leuten, von denen ich es erwartet hätte, kam hingegen nichts. Solch eine Verhärtung finde ich im Theater deshalb schlimmer als anderswo, weil es sich die ganze Zeit mit den „ach so guten idealistischen“ Themen beschäftigt und mit den „ach so menschlichen und empathischen“ Problemen. Wenn diese Sensibilität nicht vorhanden ist, wird das, was man auf der Bühne macht, eine verlogene Geschichte. Das ist wie schlechte oder zynische Aufklärung.
Vorne hui und hinten pfui. Eigentlich sollte das Theater es besser wissen. Ich finde das zutiefst schockierend, weil Film und Theater dieses Schild vor sich her tragen: „Wir sind ein Kollektiv. Nichts geht ohne den anderen!“ Das wird fünf Mal am Tag wiederholt, aber wir handeln gerne so, daß wir den anderen in die Zwangslage des Devotisten drängen.
(…)